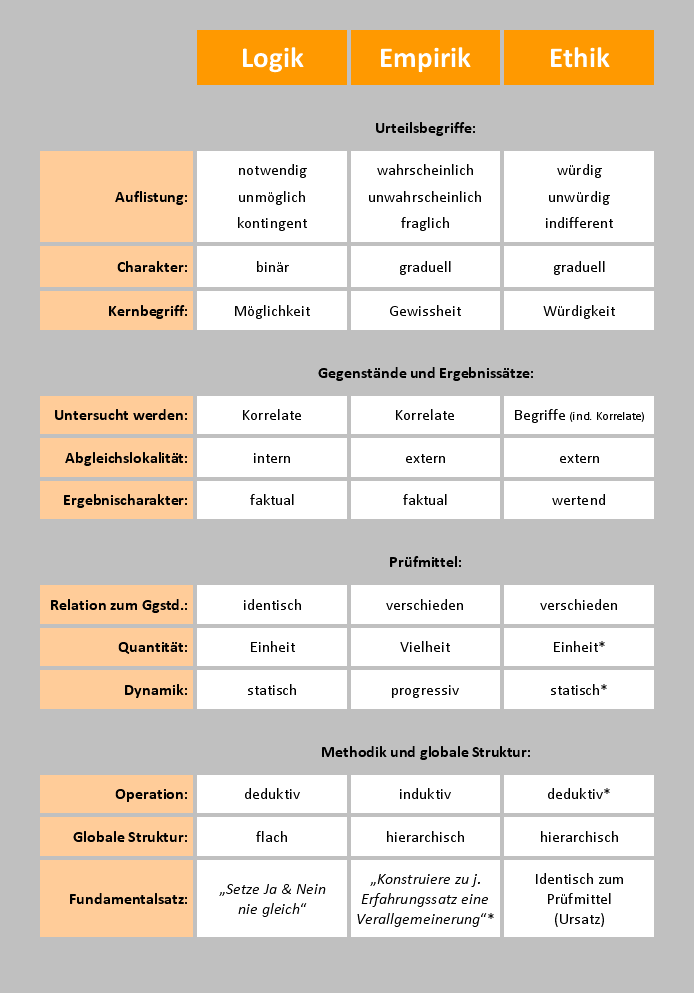Urteil und Erkenntnis
Wenn vom Verstand oder von rationaler Erkenntnis die Rede ist, sollte auch gewusst sein, was Erkenntnis und Verstand überhaupt sind, wie sie funktionieren und was ihre Grundlagen sind. Sonst läuft man Gefahr, Konzepte und Argumentationen für vernunftgemäß zu halten, die dies gar nicht sind.
Sicherlich könnten wir die Wege zur Erkenntnis einfach der Intuition der Menschen überlassen und uns mit der Erinnerung an die Wahrheiten begnügen. Tatsächlich lassen sich die primären Grundwahrheiten erkennen, ohne geisteswissenschaftlich tiefschürfende Diskurse über sie zu führen und sich in das hierfür nötige Vokabular einzuarbeiten. Die Voraussetzung hierfür ist lediglich die vorausgegangene, von Entschlossenheit und Konsequenz geprägte Selbstkonditionierung darauf, Gegebenheiten weit ab von persönlichen Neigungen, Launen, Begierden und verfälschenden (insbesondere sozialen) Einflüssen zu beurteilen, um zur Wahrheit vorzudringen. Ein ideales Beispiel hierfür sind Abraham und Mohammed , die sich beide vor ihrem Prophetentum vom Trubel der Menschen in die Natur zurückzogen, um den Kosmos und sich selbst weit entfernt von den Verlockungen des Menschenweltlichen und den Ablenkungen des Alltags tief zu betrachten.1 Es wird angenommen, dass ihre Herzen hierdurch die Klarheit und Lauterkeit erreichten, die sie für den Empfang der Offenbarung bereit machte.
Rationale Erkenntnis ist also nicht unbedingt an sprachlich oder gar fachsprachlich formulierte Disputationen im Rahmen abstrahierender Dialektik2 gebunden. Vielmehr können durch Selbsterziehung und die damit einhergehende Kontrolle der Selbstheit und der Emotionen und das Hineinhorchen in das eigene Innere intuitive Mechanismen zur Entfaltung bringen, die ohne den Ballast disputativer Formulierungsbemühungen und mancher irreführender Eigenheiten der menschlichen Sprache sogar effektiver und effizienter sein können als langwierige analytische Diskurse. Dies dürfte auch die bisweilen erstaunliche Weisheit, die manche scheinbar ungelehrten und vielleicht sogar analphabetischen Menschen unter Beweis stellen, erklären. Rationalität und Gefühl schließen sich eben nicht aus, zumal beharrliche Übung das Gefühl in den Dienst der Ratio bringen kann und zwischen Gefühl, Emotion und Einbildung gut differenziert werden muss. Denn jede Emotion ist zwar ein Gefühl oder geht mit einem solchen einher - und trägt den Ruf als eine der größten Gefahren für ein klares Urteilsvermögen weitgehend zu Recht - doch längst nicht jedes Gefühl ist eine Emotion. Es gibt eine spezielle Art des Gefühls, welche noch vor allen sprachgestützten Strategien systematisch abstrahierender Dialektik den ursprünglichen Sensor darstellt, um zu rationaler Erkenntnis zu gelangen.3 Doch nur in jemandem, der ernsthaft darauf Wert legt, diese Art des Gefühls auf der Grundlage der Selbstkontrolle und Gewissenhaftigkeit zu kultivieren und dies auch umsetzt, ohne lange Zeiträume zu scheuen, und die dazugehörige spezielle Sensibilität durch den praktischen Umgang mit dem Gefühl stärkt, wird es zu einer ausreichenden Reife, Feinheit und Zuverlässigkeit heranwachsen, die unter Anderem ausschließt, dass man es mit anderen Gefühlen verwechselt und Einbildungen zum Opfer fällt.
Dies bedeutet aber nicht, dass sprachgestütztes dialektisch-analytisches Denken und Hinführen zu den Grundwahrheiten zwingend im Kern andere Wege beschreitet als das intuitive Denken, auch wenn ersteres insbesondere aus kommunikationsproblematischen Gründen einerseits bisweilen gewisse Umwege gehen muss und andererseits auf Manchen den Eindruck der schweren Zugänglichkeit macht. Vielmehr besteht mindestens ein Teil des Anspruchs abstraktiver Dialektik gerade darin, intuitive Erkenntnisprozesse mit all ihren relevanten subtilen Details gewissermaßen sprachlich abzubilden, wenn auch notgedrungen wie zweckmäßig in idealisierender und reduzierter Form, was sie von der Realität der häufig geradezu „organisch“ zustandekommenden intuitiven Erkenntnis, weit entfernt scheinen lassen kann.
Der Eindruck der schweren Zugänglichkeit sollte derweil nicht verwundern, denn nur weil etwas an sich theoretisch von jedem einfach erfasst werden kann, bedeutet nicht unbedingt, dass die Alltagssprache so darauf zugeschnitten ist, dass damit zusammenhängende Beschreibungen und Begründungen niemandem Mühe bereiten. Schon geringe Verschachtelungen und Verkettungen von trivialen Sachverhalten (deren Kategorisierung und standardisierte Benennung im Alltag zunächst niemand für nötig halten würde) erfordern häufig Beschreibungsweisen und spezifische Termini, die den ungeübten Leser vor eine Herausforderung stellen können. Dies ist aus vielen Bereichen bekannt, z.B. der Chemie, der Genetik oder sogar aus der Muttersprache: Schon Kinder ab einem gewissen Alter können ohne explizite Hinweise zur unterbewussten Erkenntnis gelangen, dass „ein Prädikat im Gefüge eines normalen deutschen Aussagesatzes das zweite Satzglied sein muss und ihm in dieser Funktion ein kausaler Nebensatz als Teil des Gesamtsatzes direkt vorausgehen darf“, oder „dass ohne ein gesondertes Subjekt die Konjugation des Verbes zum Ausdruck desselben auch dann nicht ausreicht, wenn sie eindeutig ist“. Diese Sachverhalte sind für das Kind einfach genug, um sie sogar in die Sprachpraxis einfließen zu lassen - die eben zu lesenden Beschreibungen derselben Sachverhalte hingegen stellen nicht nur das Kind, sondern auch manchen gebildeten Erwachsenen vor eine Herausforderung. Und nicht zu vergessen können auch triviale Sachverhalte von subtiler Natur sein, und Subtiles auszudrücken und den Ausdruck zu verstehen kann sich erfahrungsgemäß recht aufwendig gestalten.
Ein weiterer Faktor, der den irreführenden Eindruck verstärken kann, dass intuitives und dialektisches Urteilen im Kern nichts miteinander zu tun haben, ist die auf der dialektischen Ebene nicht selten zusätzlich nötige Auseinandersetzung mit Argumenten gegnerischer Standpunkte und die Behandlung von befürchteten oder tatsächlichen Einwänden, was entsprechende Abhandlungen enorm aufblähen kann und weiter die Ähnlichkeit zu intuitivem Denken, das im Rückblick dagegen manchmal einem unscheinbaren Lufthauch gleicht und in seinen Schlüssen meist fulgurativ wirkt, vermissen lässt.
Es klingt sicher bereits an, wie verfehlt es ist, zu meinen, dass abstrahierende Dialektik angesichts der Möglichkeiten der menschlichen Intuition überflüssig sei, und dass man sich immer und uneingeschränkt auf dieses intuitive Potential bei der Lenkung des eigenen und der Blicke Anderer auf die Grundwahrheiten verlassen könne. Denn der Nutzen abstrahierender Dialektik und die Zwecke, welche sie weiterhin erfüllt, sind zahlreich:
- Sie kann sich als gute Hilfestellung für intelligente, aber noch unentschlossene Menschen erweisen. Ihr Erkenntnisprozess kann möglicherweise beschleunigt oder seine Versandung verhindert werden.
- Zu Ehren der Wahrheit, aber auch zur Ermutigung schwach Überzeugter, die sich von der evtl. Überlegenheit vortäuschenden Attitüde der Vertreter abweichender Standpunkte leicht beeindrucken lassen, lässt sich mit ihr nachvollziehbar machen, dass der vertretene Standpunkt im Diskurs der in Wirklichkeit überlegene ist.
- In der Regel fehlt es weder in der umgebenden Realität an Stimmen noch in der eigenen Psyche an unwillentlichen Gedanken, die auf persönlich-intuitionellen Wegen gewonnene Erkenntnisse streitig zu machen suchen bzw. geeignet sind, diese streitig zu machen, indem sie nahelegen, Einbildungen, Wunschvorstellungen oder gar einem psychischen Defekt aufgesessen zu sein und das rational konstruktive Gefühl mit anderen Gefühlen oder naiven Neigungen verwechselt zu haben. Bekanntlich blieben derartige Suggestivitäten nicht einmal auf Abraham und Mohammed ohne eine zumindest flüchtige Wirkung4 - wie erst ist dies beim durchschnittlichen heutigen Menschen zu befürchten? Hochwertige Dialektik kann hier festigend wirken und ist hierfür im heutigen modernen Zeitalter womöglich wichtiger denn je, denn:
- wir leben in einer Zeit, in der die Rolle von Gefühl und Intuition in Erkenntnisprozessen stark marginalisiert wird, und in der Menschen im Zuge der vorherrschenden Kultur prinzipiell erzogen werden, allem, was nicht intersubjektiv nachvollziehbar und somit in seinen detaillierten Grundlagen schwarz auf weiß allgemein für die Einsichtnahme zur Verfügung steht, zu misstrauen,
- im Vergleich zu den Zeiten der Propheten hat die Abgeschnittenheit einer
enormen Anzahl von Menschen von der Natur und ihrer die intuitive
Erkenntnis fördernden Eindrucksfülle extreme Ausmaße angenommen,
- wir leben in einer Zeit, in der die Rolle von Gefühl und Intuition in Erkenntnisprozessen stark marginalisiert wird, und in der Menschen im Zuge der vorherrschenden Kultur prinzipiell erzogen werden, allem, was nicht intersubjektiv nachvollziehbar und somit in seinen detaillierten Grundlagen schwarz auf weiß allgemein für die Einsichtnahme zur Verfügung steht, zu misstrauen,
- Es wäre vermessen oder zumindest übertrieben pessimistisch, an der Existenz von Menschen zu zweifeln, die infolge einer für die Moderne typischen gestörten bzw. überlagerten intuitionellen Leistungsfähigkeit zwar bereits irgendeine abwegige Überzeugung hegen, aber lediglich im Sinne einer vorläufigen Überzeugung, während sie zugleich für kohärente dialektische Darlegungen zugunsten alternativer Überzeugungen offen und grundsätzlich bereit sind, sich dem Standpunkt der stärkeren dialektischen Argumentation anzuschließen.
- Manche Menschen sind aufgrund ihres beruflichen oder sonstigen Hintergrundes dialektisches Denken und Argumentieren gewohnt und sind über eine andere als die Sprache der Dialektik nicht erreichbar. Im Aufruf zum Wege Gottes die betreffende Zielgruppe in ihrer Sprache anzusprechen, entspricht einem aus dem Ehrwürdigen Koran bekannten Usus der Gesandten.5
Dabei soll nicht geleugnet werden, dass Dialektik nicht unbedingt alle relevanten Arten intuitiven Denkens abbildet, denn während (die bis hierhin gemeinte) Dialektik echte Erkenntnis und objektiv korrekte Urteile zum Ziel hat, müssen intuitive Denkprozesse nicht immer in Erkenntnis im strengen Sinne münden, um „gut“ oder in einem anerkennungswürdigen Sinne brauchbar zu sein. Letzteres kann nämlich auch dann der Fall sein, wenn der Prozess anstelle eines objektiv korrekten Urteils zu einer gesunden, mit der Natur des Menschen (u.a. als Vernunftwesen) harmonierenden Haltung führt.6 Sicherlich ist jedes objektiv korrekte, auf objektiv korrekte Weise (!) erreichte Urteil als eine gesunde Haltung anzusehen. Längst noch nicht muss sich aber jede gesunde Haltung in einem auf jene Weise erreichten Urteil manifestieren. Nichtsdestotrotz spricht nichts dagegen, argumentative Dialektik auf die Abbildung auch solcher intuitiven Prozesse auszuweiten, solange im Bedarfsfall entsprechende Kennzeichnungen an den Stellen dieser Ausweitung nicht fehlen.
Ebenfalls ist abstrahierende Dialektik möglich, welche Denkprozesse repräsentiert, die auf keiner nicht-dialektischen Ebene ohne hohen Aufwand initiiert und durchlaufen werden können und somit, außer vielleicht in Bezug auf außerordentlich hoch begabte Menschen, recht intuitionsfern ist. Ob sie zu richtigen oder falschen Ergebnissen führt, ist allerdings hiervon unabhängig.
Ohne die besagte Ausweitung lassen sich die intuitiven Denkprozesse, welche abstrahierender Dialektik zugrunde liegen, dementsprechend als Schnittfläche zwischen Dialektik allgemein und Intuition allgemein vorstellen.
1. Was ist Erkenntnis?
Auch wenn es hier um diejenige Erkenntnis (V) geht, in welche rationale Denkvorgänge münden,7 ist es dennoch zur Analyse des Begriffs aufschlussreich, seine mit der Sinneswahrnehmung verknüpfte Ausprägung zu betrachten: „Ich erkenne zwischen den Blumen ein Veilchen.“ Der Sprecher dieses Satzes meint, dass er einen Gegenstand wahrnimmt, den er in die Kategorie der Veilchen einordnet, und zwar richtigerweise einordnet. Dieses Einordnen ist essentiell, während hingegen die Wahrnehmung alleine nicht genügt, um von einer Erkenntnis sprechen zu können, zumal man oft genug etwas wahrnimmt, ohne zu erkennen, was es ist (in seiner extremen Form ist dies ja sogar als neuropathologisches Syndrom bekannt).8 Man mag z.B. eine schöne Melodie wahrnehmen, die einem vielleicht sogar bekannt vorkommt, ohne zu erkennen, um was für eine Melodie es sich handelt. Erst, wenn man sie mit einer Melodie, die man schon einmal gehört hat, und an die man sich noch erinnert, auf gültigen Grundlagen (also nicht nur aufs Geratewohl) identifiziert, d.h. die beiden als identisch beurteilt, und zwar korrekt beurteilt, also diese und die abgespeicherte Melodie tatsächlich im Wesentlichen identisch sind, kann man von einer (hier noch primitiven) Erkenntnis sprechen.
Wie damit zu sehen ist, kommt der Begriff des Urteils (V) im Begriff der Erkenntnis vor. Diese Tatsache verlangt nach einer Differenzierung, zumal Differenzierungen zwischen nahe beieinanderliegenden Begriffen zu ihrer besseren Erfassung beitragen, so auch im Falle der Begriffe des Urteils und der Erkenntnis. Eine wichtige, dem Sprachgebrauch zu diesen Begriffen entnehmbare Differenz zwischen Urteil und Erkenntnis ist nun, dass ein Urteil auch falsch sein kann, während schon im Begriff der Erkenntnis festgelegt ist, dass eine solche immer korrekt ist. Man kann nichts „falsch erkennen“. Zudem sind Erkenntnisse immer nur etwas, was in unserem Inneren stattfindet, Urteile hingegen können sowohl etwas bloß Innerliches als auch etwas in die Außenwirklichkeit Hineinreichendes, „sich Äußerndes“ sein.
Lernen
Ein Abgleich der Kriterien für das Vorliegen von Erkenntnis mit den Kriterien für das Vorliegen von Wissen9 bestätigt eine intuitiv evidente Tatsache hinsichtlich einer besonderen Eigenschaft der Erkenntnis: Erkenntnis geht mit der Entstehung von Wissen (S) einher. Oder besser: Erkenntnis ist Entstehung (bzw. Erwerb) von Wissen. Sie ist im Menschen die primäre und ursprünglichere der beiden natürlichen Formen der Entstehung von Wissen. Intuitiv evident ist dies angesichts der offensichtlichen Widersprüchlichkeit einer Aussage wie: „Ich habe erkannt, dass es so ist, aber ich weiß es nicht.“ Die zweite Form der Entstehung von Wissen ist derweil das Lernen, soweit die Lehrquelle und ihre allgemeine oder partikuläre Referenz hinreichend verlässlich sind. Damit der auf diesem zweiten Wege zu Wissen gekommen zu sein Beanspruchende zu Recht sagen kann, er wisse das Gelernte, auch wenn er es nicht selbst direkt erkannt hat, muss sein Lernen nichtsdestotrotz auf einer Erkenntnis gründen, nämlich seiner Erkenntnis, dass die lehrende Quelle und ihre Referenz verlässlich sind. Dies bestätigt, dass Erkenntnis die ursprünglichere Form der Wissensentstehung ist.
Genau betrachtet ist das eben besagte Lernen, wenn man es neben Erkenntnis stellen möchte, bereits ein spezielles, nämlich das vermittlungsbasierte Lernen. Denn Lernen allgemein ist nicht nur eine Form der Wissensentstehung, sondern es handelt sich hier mehr oder weniger um ein und denselben Begriff. Aktives Lernen ist die Herbeiführung der Entstehung von Wissen im eigenen Inneren - am arabischen Vokabular sieht man es besonders gut: ta'allama تعلم („lernen“) geht sichtbar auf die Wurzel 'lm علم („Wissen“) zurück und bedeutet wörtlich „sich wissend machen“, d.h. „sich Wissen aneignen“. Soweit unser Wissen nun auch unwillkürlichem Lernen entstammt, ist eine noch weiter gehende Identifizierung der Begriffe miteinander möglich, denn dann fällt der Aspekt der von der lernenden Person veranlassten Herbeiführung weg. Wohl niemand hätte etwas dagegen einzuwenden, über eine Person, in deren Inneren auf wundersame Weise plötzlich Wissen entstanden ist, zu sagen, sie hätte in jenem Augenblick – wenn auch auf unerklärliche Weise – etwas Neues gelernt.
Wenn jede Entstehung von Wissen ein Lernen ist und jede Erkenntnis Entstehung von Wissen, ergibt sich syllogistisch: Jede Erkenntnis (V) ist ein Lernen. Dies bedeutet natürlich nicht, dass jedes Lernen (partikuläre) Erkenntnis ist. Man beachte nämlich, dass sich sagen lässt, jemand habe „etwas Unwahres (als wahr) gelernt“, ohne dass sich mit der gleichen Selbstverständlichkeit sagen lässt, er habe „etwas Unwahres (als wahr) erkannt“. Eher erscheint Letzteres als purer Widerspruch in sich. Entweder erkennt man wahre Dinge bzw. Sachverhalte, oder man erkennt gar nichts.
Nebenbei erweist sich angesichts der Möglichkeit des Lernens von Unwahrem, dass „Lernen“ entweder ein multikonzeptioneller Terminus ist10 oder eine Feinjustierung seiner obigen Definition vorgenommen werden muss, die den Aspekt des Wissens (S) mit dem Aspekt dessen, was für Wissen (S) gehalten wird, ersetzt. Demnach wäre Lernen die Entstehung von für Wissen Gehaltenem oder die Herbeiführung dieser Entstehung.
Einordnen und Differenzieren
Demgegenüber ist Erkenntnis, zumal sie ja ein spezielles Lernen ist, nicht nur die Entstehung von für Wissen Gehaltenem, sondern die Entstehung von für Wissen Gehaltenem, das auch Wissen ist, kurz (und wiederholend): Entstehung von Wissen. Das ist aber nur eine Einordnung des Erkenntnisbegriffs unter einen Oberbegriff, die noch nicht zum Wesen des Begriffs vordringen lässt. Darum sollte der eine oder andere wesentliche Bestandteil des Begriffs unter die Lupe genommen werden. Als einen solchen haben wir bereits den Begriff des Urteils (V) identifiziert. Was aber ist eigentlich ein Urteil (V)? Den Beispielen mit dem Veilchen und den Melodien lässt sich nach einer unter dem Aspekt dieser Frage erneut durchgeführten Betrachtung entnehmen, dass Urteilen ein Einordnen bzw. Zuordnen ist, jedoch nicht irgendein solches, sondern eines nach Kriterien, anhand derer verglichen wird, darüber hinaus eines ohne Vorbehalt, d.h. ein als unabänderlich gemeintes, da als korrekt angesehenes Einordnen. Nicht so gemeinte und angesehene, mit Vorbehalt behaftete Ein- und Zuordnungen nennen wir hingegen Vermutungen.
Die Herausforderung daran, zu Erkenntnis zu gelangen, besteht nicht in der Kenntnis der formalen Grundlagen der Beschreitung des Weges dorthin, soweit diese weitgehend trivial und (zumindest früher oder später) unstrittig sind, z.B. die Gültigkeit der klassischen Syllogistik (die heutige Infragestellung ihrer Leistungsfähigkeit sollte nicht als Infragestellung ihrer Gültigkeit missverstanden werden). Die Herausforderung besteht vielleicht nicht einmal hinsichtlich der Anwendung von Regeln des Schließens aus gegebenen Prämissen. Das eigentliche Problem ist vielmehr die Auffindung und korrekte Zusammenstellung dieser Prämissen; diese nämlich beruhen zu ihrer Korrektheit einzig und allein auf der korrekten Differenzierung der Gegebenheiten. Man kann die fehlerfreieste Schlussfolgerung anstellen - es hilft alles nichts, wenn die Prämissen uneindeutige (also ungenügend voneinander getrennte Bedeutungen tragende) Ausdrücke beinhalten. Am Ende wird, außer mit Glück, ein falsches Urteil stehen. Statt von korrekter Differenzierung können wir äquivalent auch von etwas sprechen, dass uns aus nicht weit zurückliegenden Ausführungen bekannt vorkommen wird: nämlich von der korrekten Einordnung in Kategorien. Denn keine zwei Dinge können voneinander unterschieden werden, ohne eines der beiden oder beide woanders als zuvor einzuordnen. Dies geht analog zur Unterscheidung in der empirischen Realität, in welcher keine zwei Dinge voneinander entfernt werden können, ohne mindestens eines der beiden einem anderen Ding oder einem anderen Ort als dem bisherigen anzunähern. Keine zwei Schachfiguren, die auf demselben Feld stehen, können voneinander getrennt werden, ohne dass danach mindestens eine der beiden auf einem anderen Feld steht.
Wenn es also von alters her heißt, dass das arabische Wort ħikmah („Weisheit“), welches ja bezeichnenderweise vom Verb ħakama („urteilen“) kommt und das wurzelgleiche ħukm („Urteilskraft“, wrtl. „Urteil[-en]“) im Ehrwürdigen Koran11 synonym dazu verwendet wird, bedeute, etwas an seinen richtigen Ort zu setzen bzw. die Fähigkeit hierzu,12 so hätte es dem Begriff im Endeffekt nichts hinzugefügt und nicht viel entzogen, wenn statt vom Setzen (Einordnen) wiederum vom Differenzieren die Rede gewesen wäre. Bemerkenswert ist auch, wie schon im Deutschen durch die Bestandteile von Ausdrücken wie „Urteil“ oder „Entscheiden“ die Assoziation des Differenzierens bzw. Trennens vermittelbar ist.
Das nämlich ist anscheinend das, worin die Drehachse des ganzen Erkenntnisvermögens besteht: Die Fähigkeit zum Erkennen von Gemeinsamkeiten, also zum (korrekten) Einordnen in Kategorien bzw. zum Kategorisieren, und zum Erkennen (und Würdigen) von Unterschieden, also zum (korrekten) Differenzieren.
Die Anwendung des Wortes „erkennen“ im Alltag der Sinneswahrnehmung bestätigt dies: Wird ein Patient beim Augenarzt gefragt, ob er an der Wand projizierte Buchstaben erkennen könne, wird er diese Frage nicht wahrheitsgemäß bejahen können, wenn er die Buchstaben trotz allen Zusammenkneifens der Augen voneinander nicht unterscheiden kann, und auch nicht, wenn er zwischen keinem der in seinem Gedächtnis gespeicherten und den projizierten Buchstaben eine Gemeinsamkeit feststellt. - Wer nie die geringste Helligkeit wahrgenommen hat und nie wahrnimmt, und somit keine Möglichkeit hat, mit ihr die Dunkelheit zu vergleichen und sie von ihr zu unterscheiden, dem fällt die Dunkelheit, in der er sich befindet, nie auf, und umgekehrt.13
Verstehen
Hier geht es aber nicht um triviales, sinnliches Erkennen, das über die Sinnesorgane zugetragene Sinnesdaten oberflächlich unterscheidet und zuordnet, sondern vielmehr um das Erkennen von Sachverhalten, die für die oberflächlichen Sinne unsichtbar und somit im ersten Schritt unerkennbar sind. Somit geht es sozusagen um eine zweite Ebene des menschlichen Erkennens, mag man diese Ebene je nach Bezugnahme auf ihren Wert oder aber den mit ihr verbundenen Aufwand nun „höher“ oder „tiefer“ nennen. Bei den im ersten Schritt unerkennbaren Dingen kann es sich durchaus um ganz Banales und Profanes handeln, z.B. dass ohne weiteres der Kassierer im nächsten Supermarkt einem die auf
das Fließband gelegten Waren für ein selbstgemaltes Bild statt für Geld
kaum überlassen wird. Die Unsichtbarkeiten: Bevor man sich auf den Weg
dorthin macht, sieht man nicht einmal den Supermarkt, geschweige denn
den Kassierer oder die Situation des „Bezahlens“, und dennoch ist das
Zutreffen der negativen Erwartung hier sicher. Ein weiteres Beispiel ist, inwiefern Haltung und Mimik eines Gegenübers echt oder gespielt sind, und was es wahrscheinlich (wirklich) fühlt.
Entsteht das Wissen in einer Person aufgrund eigener innerer Bemühung, ohne dass das Wissen absichtsvoll kommunikativ mitgeteilt wurde, handelt es sich bei dieser Wissensentstehung um eine Erkenntnis derjenigen Art, um die es in diesem Artikel geht. Im Folgenden ist es denn von den beiden Begriffen des Erkennens bzw. der Erkenntnis nur noch dieser, auf den Bezug genommen wird.
Eine solche spielt schon in der sprachlichen Kommunikation eine unverzichtbare Rolle: „Das Kind hat sich einen Amerikaner gekauft und ihn zur Hälfte aufgegessen.“ Dass es sich in diesem Satz bei dem Amerikaner nicht um einen Menschen, sondern um ein Gebäck oder zumindest eine Speise handelt, ist eine Erkenntnis der (wenn auch hier nur geringfügig) höheren Ebene, zumal den Sinnen alle Elemente der von dem Satz referenzierten Realität (Kind, Essen, gegessener Gegenstand) und erst Recht der Vorstellung des Sprechers verborgen sind und nur die Zeichen des Satzes wahrnehmbar sind. Hierin wird deutlich, dass ungeachtet der Tatsache, dass bei rein kommunikationsbasiertem Lernen Lehrinhalte nicht partikulär erkannt werden, solches Lernen unter einem weiteren Aspekt - neben demjenigen der Bewertung der Lehrquelle - ohne die allgemeine Fähigkeit zu partikulärem Erkennen nicht auskommt.
An letzterem Beispiel lässt sich auch sehen, wie eng die Begriffe des Erkennens und des Verstehens miteinander verknüpft sind: Das Erkennen von Bedeutungen gehört zum Verstehen von Sprache. Der Satz „Ich verstehe, was du meinst“ ist gleichbedeutend mit dem Satz „Ich erkenne, was du meinst“. Dennoch gibt es einen Unterschied im deutschen Sprachgebrauch: Im Deutschen kann man den Satz „Ich habe den Text verstanden“ nicht ersetzen mit dem Satz „Ich habe den Text erkannt“. Das Substitut müsste vielmehr lauten: „Ich habe die Bedeutung des Textes erkannt.“ Nichtsdestotrotz ändert es nichts an der Feststellung: Jedes Verstehen ist ein Erkennen oder wenigstens mit Erkenntnis verbunden.14 (Umgekehrt gilt dies nicht: Manches Erkennen ist kein Verstehen, so zum Beispiel das Erkennen von Gesichtern.)
Damit sind wir nach der Klärung der Begriffe des Urteils und der Erkenntnis zu der Frage angelangt, was Verstand eigentlich ist. Es würde uns hierbei nicht sehr weit bringen, esoterische, von dem einen oder anderen Kleriker vertretene Definitionen zu übernehmen, denen zufolge der Verstand ein „geisthaftes Licht“ (nûr rûħâniyy)15 sei - vielmehr unterstreichen solche völlig inhaltsleeren und unbelegbaren Auslegungen die Dringlichkeit, bei diesem Begriff für definitorische Klarstellungen zu sorgen. Immerhin ist zu befürchten, dass Anhänger solcher Auffassungen felsenfest überzeugt sind, rationale Erkenntnisse zu haben, die aber von Rationalität in Wirklichkeit kaum weiter entfernt sein können. Unklarheit über den Verstandesbegriff erleichtert es außerdem Polemikern, an die Wahrheit glaubenden Menschen einzureden, sie handelten dem Verstand zuwider. Die mit solchen Diffamierungen Konfrontierten sind in ihrer Perplexität und Beschämtheit häufig nicht in der Lage, den Polemikern aufzuzeigen, dass in Wirklichkeit diese es sind, deren Haltung von Unverstand zeugt. Als letzten Ausweg sehen viele für sich nur noch, sich in die Berufung auf die schwer bis gar nicht nachweisbare Herz-Verstand-Dichotomie zu flüchten.
Die vorzunehmende Klarstellung des Verstandesbegriffs ist einerseits zwar nicht so schwer, dass man auf ominöse Inhaltslosigkeiten ausweichen muss, andererseits aber doch nicht ganz trivial, denn wir haben es hier - was manche vielleicht überraschen mag - mit einer multikonzeptionellen Vokabel zu tun.
Zunächst ist „Verstand“ offensichtlich nichts weiter als die sprachliche Substantivierung von „verstehen“,16 wie auch „Stand“ von „stehen“, „Gang“ von „gehen“, „Schwund“ von „schwinden“, und so weiter. Als Erstes kommt daher in Frage, den Akt, das Ereignis oder den Vorgang des Verstehens als „Verstand“ zu bezeichnen. Dies ist problematisch, denn jedes Verstehen ist zwar ein Erkennen, aber nicht jeder, über den sich sprachlich sagen lässt, er besitze Verstand, erkennt unbedingt in jedem Augenblick, in dem sich über ihn jenes sagen lässt, etwas. Es ist dennoch nichts dagegen einzuwenden, festzuhalten, dass es (zusätzlich zu Verstand (S)) etwas als Verstand (V) bezeichnet zu werden Geeignetes gibt, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was wir suchen. Das Gesuchte hingegen ist dem Sprachgebrauch nach zu urteilen offensichtlich etwas, was man besitzen kann.
Nun kann man nur zweierlei besitzen: Entweder eine Sache oder eine Eigenschaft (und sei es auch nur eine kontextuelle Eigenschaft, wie z.B. einen Spielermarktwert). Im Verstand eine Sache bzw. ein Ding zu sehen, ist sprachlich mindestens im Sinne eines Metonyms möglich - fraglich ist jedoch, ob dies uns weiter bringt. Denn dafür, was dieses Ding sein soll, kommt sehr Verschiedenes in Frage, darum sehen manche im Verstand ein Gerät oder ein Organ, andere eine wie die oben genannte geisthafte Lichtentität... Und selbst wenn wir wüssten, welches dieser Dinge dafür in Frage kommt,17 würde uns ohnehin weniger interessieren, was seine außenwirkliche Natur ist oder woraus es substantiell besteht, als was es macht und wie man es benutzt. Darum gibt es, wenn mit Verstand keine reine Eigenschaft gemeint ist, nur einen sinnvollen Definitionsansatz: Verstand ist ein innerliches Mittel bzw. die Gesamtheit der innerlichen Mittel zur Erreichung höherer (d.h. über triviale Sinnesurteile hinausgehender) Erkenntnis. Das ist natürlich noch keine ausreichende Definition, sondern eben der Ansatz zu einer solchen. Hierfür müsste noch ausgeführt werden, worin konkret die besagten Mittel bestehen. Dies ist das Thema eines späteren Kapitels.
Ist Verstand aber eine reine Eigenschaft, dann ist keine Definition plausibler als diejenige, die den Verstand als Fähigkeit zum Erkennen definiert. Unter diesem Aspekt ist der Verstand des Menschen also sein Erkenntnisvermögen. Dies bestätigt sich in der Etymologie des deutschen Wortes „Verstand“, denn es ist sozusagen ein phonetisch leicht modifiziertes „Vorstand“ (althochdeutsches Verb: farstān) im Sinne eines „Davorstehens“.18 Im trivialen Bereich der alltäglichen Sinnesurteile ist ja mit einem Davorstehen verbunden, dass man dann, wenn man vor einem Gegenstand steht - und häufig erst dann - diesen und Einzelheiten von ihm erkennen kann. Wenn „Davorstehen“ nun gleichbedeutend damit ist, erkennen zu können, ist Verstand etymologisch betrachtet tatsächlich Erkenntnisvermögen. - Aufgrund der Inbegriffenheit des Urteils- im Erkenntnisbegriff lässt sich diese Eigenschaft auch „Urteilsvermögen“ nennen, wobei diese Benennung insofern gröber ist, als man sich stets hinzudenken muss, dass sie nicht jedwedes, sondern korrektes, innerliches Urteilen meint.
Aufbauend auf dem Bisherigen lässt sich das Spektrum der möglichen Begriffe für den Terminus des Verstandes wie folgt darstellen:
- aktuale Erkenntnisvorgänge
- ein innerliches Instrumentarium (zur Erreichung höherer Erkenntnis)
- ein Erkenntnisvermögen (bezogen auf höhere Erkenntnis)
Den ersten Begriff, der ohnehin nicht „Verstand (S)“, sondern nur „Verstand (V)“ zugrundeliegen kann, haben wir bereits beiseite gelegt, er ist nur der Vollständigkeit halber aufgeführt.
Die verbleibende Multikonzeptionalität ist vielleicht nicht weiter tragisch, denn beide letzte Punkte bedürfen noch einer Spezifikation, ohne welche die beiden Begriffe zu unscharf sind, um Feststellungen zuzulassen, ob etwas im Einklang mit dem Verstand steht oder ihm widerspricht. Für einen verlässlichen Verstandesbegriff muss diese Spezifikation etwas sein, das ihnen beiden gemeinsam ist, und dessen Fehlen zugleich das Fehlen jenes Instrumentariums als auch des Vermögens bedeuten muss. Es muss etwas sein, was den Verstand - zusätzlich zur bereits jetzt beiden gemeinsamen Ermöglichung von Erkenntnis - ausmacht, egal ob man ihn als Mittel oder als Vermögen auffasst.
Die der instrumentaristischen Definition noch fehlende Spezifikation ist die Antwort auf die Frage, woraus sich das Instrumentarium zusammensetzt bzw. worin es besteht. Die der potentialistischen Definition noch fehlende ist die Antwort auf die Frage, worauf sich das Vermögen gründet bzw. wodurch es zustandekommt. Und diese beiden Antworten müssen identisch sein oder wenigstens einander umfassen.
2. Die Triade des menschlichen Urteilsvermögens
Es ist ein wohl nicht unverbreiteter Irrtum, der Grad der Urteilsfähigkeit eines Menschen sei ausschließlich angeboren, statisch und könne in keiner Weise zunehmen. Ein einfaches Beispiel widerlegt dies: Jemand mag zunächst nicht in der Lage sein, Angaben über die Länge der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, von dem nur die Längen der Katheten gegeben sind, zu beurteilen. Er lässt sich aber hierzu in die Lage versetzen, indem man ihm den Satz des Pythagoras und dessen Anwendungsweise beibringt. Seine Urteilsfähigkeit lässt sich also, und sei er auch eine ansonsten nur durchschnittlich intelligente Person, zumindest hinsichtlich eines speziellen Aspekts vergrößern.
Freilich ist die in diesem Beispiel angeführte Art des Ausbaus der Urteilsfähigkeit keine besonders hochrangige - für unseren Zweck der Definition des Rationalen ist das Beispiel jedoch ausreichend. Es zeigt, dass sich Urteilsfähigkeit durch die Erweiterung des geistig-theoretischen Instrumentariums vergrößern lässt. Letzteres ist im Übrigen die Art des gesuchten Instrumentariums, nicht die materiell-organische, die auf der neurologischen Ebene sicher auch existiert, aber uns hier nicht weiterführt, sondern eben die geistig-theoretische: In dem Beispiel besteht es aus einem Satz und einer Methode, und zwar dem Satz des Pythagoras und seiner Anwendungsweise.
Da wir keine andere Vergrößerung des Erkenntnisvermögens außer durch den Ausbau des geistig-theoretischen Arsenals kennen (abgesehen von bloßen Effizienzsteigerungen), fallen in dem für uns relevanten Zusammenhang die Begriffe des Vermögens und des Instrumentariums offenbar zu einem einzigen Begriff zusammen. Somit ist auch der Ansatz für die identische Antwort auf die zuletzt offen gelassenen Fragen gefunden, worauf sich das Erkenntnisvermögen gründe, und woraus sein Instrumentarium bestehen müsse, nämlich auf bzw. aus Sätzen und Methoden.
Da wir über den gesamten Verstand reden und nicht nur über eine spezielle Einzelfähigkeit wie die des Urteils über die Maße rechtwinkliger Dreiecke, stehen wir vor der Aufgabe, diejenigen Sätze und Methoden zu suchen, auf die sich alle Urteilssätze und -methoden zurückführen lassen müssen, und in denen sie allesamt, wenn sie denn die Stufe der Rationalität zu Recht innezuhaben beanspruchen, wurzeln.
Im Rahmen der dazugehörigen Untersuchung wird sich herauskristallisieren, dass das rationale Erkenntnisvermögen des Menschen aus drei Komponenten besteht, ohne welche er zu keinerlei rationaler Erkenntnis zu gelangen imstande ist, nämlich:
- Logik
- Empirik
- Ethik
Was sich hinter diesen Titeln verbirgt, und warum es außerhalb dieser drei Formen des Urteilsvermögens keine rationale Erkenntnis geben kann, ist nun zu beantworten.
2.0.1 - Tertium non datur
Aus den Ausführungen in der Einleitung folgt, dass sich alle rationale Erkenntnis theoretisch sprachlich repräsentieren lässt. Zu jeder rationalen Erkenntnis lässt sich theoretisch ein Satz formulieren, der diese ausdrückt. (Für die Praxis hingegen sind hier durchaus Probleme denkbar, z.B. ein noch unzulänglicher Entwicklungsgrad der Sprache oder ihres Vokabulars, oder eine zu große Anzahl u.U. subtiler Einzelheiten komplexer Sachverhalte.) Selbst wenn es nicht so wäre, müssten wir ohnehin aus praktischen Gründen die Definition von rationaler Erkenntnis auf mit sprachlichen Mitteln referenzierbare Erkenntnis beschränken, da sonst jeder abstraktiv-dialektische Diskurs sinnlos wäre.
Hierin unterscheidet sich der Begriff der Erkenntnis übrigens vom Begriff der Erfahrung. Erfahrung lässt sich durchaus nicht immer sprachlich wiedergeben, insbesondere, wenn es sich bei ihr um eine unzusammengesetzte, individuelle und einzigartige Erfahrung handelt. Demgegenüber lässt sich zumindest theoretisch jede Erkenntnis sprachlich wiedergeben.
Dies ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass jede Erkenntnis ein Urteil ist (wenn auch nicht jedes Urteil eine Erkenntnis). Urteile lassen sich in Sätzen ausdrücken. - Nun gibt es im Grunde zunächst nur zwei Arten von echten Sätzen:
- Deklarative Sätze (Feststellung oder Leugnung)
- Imperative Sätze (Aufforderung oder Untersagung)
Übrigens: Da Sätze offensichtlich nur Ausdrucksformen sind, geht es strenggenommen eigentlich nicht um Sätze - jedenfalls nicht um solche im linguistisch-grammatischen Sinn -, sondern eben um die in ihnen enthaltenen Urteile (S) und/oder sonstigen Inhalte, bzw. (ontologisch gesprochen) um epistemisch-geistige Korrelate19 oder wesentlichen Teilen dieser. Der Einfachheit halber, und weil auch solche Inhalte von Sätzen eine Rolle spielen, die nicht auf den ersten Blick zur Kategorie der Korrelate gehören und dennoch Inhalte sind, bleibt dieser Artikel dennoch vorerst bei der Verwendung des Lexems des „Satzes“; der Leser möge im Sinn behalten, dass spätestens ab jetzt in der Regel nicht der Satz als bloße äußere Zeichenkombination gemeint ist, sondern der Inhalt derselben.20
Auf der inhaltlichen Ebene und hinsichtlich ihres Zwecks treten die beiden Kategorien auf als:
- Deskriptive Sätze
- Normative Sätze
Warum es nur deklarative und imperative bzw. unter den Allgemeingültigkeit beanspruchenden nur deskriptive und normative Sätze gibt, d.h. ein elementarer Satz entweder deskriptiv oder normativ, bzw. entweder deklarativ oder imperativ ist:21 Entweder ein Satz erfordert eine passive Haltung des Empfängers (Speichern), oder er erfordert eine aktive Haltung (Umsetzen); ein drittes Positives zu Passivität und Aktivität gibt es nicht. - Entweder der typische und primäre Zweck seiner äußeren Konstruktion ist hinsichtlich des Gesamtbestandes der vorausgegangenen Urteile des Adressaten eine Veränderung, die dieser (und sei es auch nur im Sinne einer Erweiterung) eben an diesem Bestand veranlasst, oder aber eine, die er an anderem veranlasst; ein Drittes zu An-diesem-Sein und An-anderem-Sein gibt es nicht. - Entweder, ein Satz „rechnet“ (und sei es auch u.U. fälschlicherweise) mit einer automatischen bzw. determinierten Veränderung der besagten Art, oder er stellt sie freier Entscheidung anheim; ein Drittes zu Determiniertheit und Freiheit gibt es nicht. - Entweder ein Satz hat gesetzt zu werden, oder er hat zu setzen; ein Drittes zu Gesetztheit und Setzendsein gibt es (hier) nicht. - Entweder geht ihm die von ihm referenzierte Wirklichkeit voraus, oder er geht ihr voraus22; ein Drittes hierzu gibt es nicht.23
Was ist mit Fragen? Sind sie nicht eine dritte Form nach deklarativen und imperativen Sätzen? Dies ist zu verneinen, denn Fragesätze sind abgekürzte imperative (und somit theoretisch zu normativen verallgemeinerbare) Sätze. Der Imperativ „Sag mir…“ wird durch die Frageform ersetzt. Nun mag man argumentieren, dass sich ja auch imperative Sätze in deklarative Sätze umwandeln ließen - warum gehen wir dann nicht von einer einzigen Art von Sätzen aus, nämlich von derjenigen der deklarativen? Tatsächlich scheint es, dass man imperative Sätze grundsätzlich in konstatierende Sätze konvertieren kann, vielleicht (z.B. „Gib mir den Ring“: „Es ist gewollt/gewünscht/wichtig/notwendig/unabdingbar, dass du mir den Ring gibst“). Doch die Gegenrichtung ist ebenfalls möglich (z.B. „Er hat mir den Ring gegeben“: „Sieh es als Tatsache an, dass er mir den Ring gegeben hat“). Eine solche Gegenrichtung ist im Falle der Fragesätze ausgeschlossen, denn man kann nicht jeden imperativen Satz in einen gleichwertigen Fragesatz umwandeln. Die Konvertierungen mögen näher betrachtet doch als unvollkommen oder zumindest als von unklarer Vollkommenheit erscheinen,24 würden aber in den meisten Fällen in hinreichender Weise ihren Zweck erfüllen, zudem sind Maß und Art der Unvollkommenheit der einen Konvertierungsrichtung die gleichen wie die in der anderen Richtung. Die Möglichkeit des gleichwertigen Richtungswechsels im Falle der deklarativen und der imperativen Sätze ist ein Indiz dafür, dass wir es bei den Begriffen der Deklarativität und der Imperativität, bzw. bei denen der Deskriptivität und der Normativität mit natürlichen, rein ontischen, einander komplementär ausschließenden und möglicherweise sogar elementaren Begriffen zu tun haben, zu denen sich lediglich Kontextualbegriffe konstruieren lassen, die den Anschein der gegenseitigen Einschließung wecken.25 Derweil zeigt die Unmöglichkeit des gleichwertigen Richtungswechsels im Falle der fragenden und der imperativen Sätze, dass einer der beiden Begriffe den anderen beinhaltet, nicht aber beide sich gegenseitig beinhalten.
Es ist sodann leicht einzusehen, dass der Verstand deskriptive Sätze auf keine andere als auf die folgenden zwei Weisen untersuchen kann: Entweder er vergleicht einen solchen Satz mit eben dem Satz selbst (d.h. seine Komponenten miteinander), oder er vergleicht ihn mit sonstigen Sätzen. Den untersuchenden Vergleich von deskriptiven Sätzen mit sich selbst nennen wir eine logische Untersuchung, und diejenige mit sonstigen deskriptiven Sätzen nennen wir eine empirische Untersuchung. Die Auseinandersetzung mit normativen/imperativen Sätzen gesellt sich nach dieser Aufteilung somit als etwas Drittes hinzu; wir nennen eine solche Auseinandersetzung eine ethische Untersuchung.
Eine einzelne oder aber auch die Gesamtheit aller potentiellen logischen Untersuchungen bzw. das Vermögen hierzu sei Logik, die aller potentiellen empirischen Empirik und die aller potentiellen ethischen Ethik genannt.
2.1 Logik
Die Logik26 kennt in der Untersuchung von Sätzen genau drei Urteile; eine vollständige logische Untersuchung endet ausnahmslos mit einem einzigen dieser drei Urteile:
- notwendig
- unmöglich
- kontingent
Das Zustandekommen dieser Dreiheit ist leicht nachvollziehbar, denn: Entweder ein zu beurteilender Satz beinhaltet einen Widerspruch, dann ist sein angebliches Zutreffen unmöglich. Oder seine Verneinung beinhaltet einen Widerspruch, dann ist sein Zutreffen notwendig. Oder weder er noch seine Verneinung beinhalten einen Widerspruch, dann ist sein Zutreffen möglich, genauer: kontingent27.
Die einzige verbleibende alternative Kombination, die zu diesen dreien scheinbar noch hinzutreten könnte, nämlich, dass sowohl der Satz als auch seine Verneinung einen Widerspruch beinhalten, scheidet natürlich aus, wenn man die Gleichsetzung der Verneinung eines Widerspruchs mit der Bejahung eines solchen vermeiden will.
In genau dieser Vermeidung besteht der Fundamentalsatz der Logik. Dieser lässt sich nicht weiter logisch begründen, sondern begründet selbst die Logik und lautet, dass Ja und Nein sich unter allen Umständen gegenseitig vollkommen ausschließen. Wo dies scheinbar anders ist, ist es eben (zunächst per definitionem, aber nebenbei auch durch präzise und aufmerksame Beobachtung feststellbar) nur einem Anschein geschuldet, welcher wiederum z.B. auf die Uneindeutigkeit einer Satzformulierung oder die Multikonzeptionalität einer Bezeichnung zurückzuführen sein kann.28 Es geht vielmehr um genau die eine Proposition, die gemeint ist, und nicht um ihre äußere Formulierung oder die Menge der Propositionen, die gemeint sein könnten. Sollte die Bezugnahme einer Frage auf mehr als eine Proposition tatsächlich intendiert sein, ist ihre Beantwortung mit direkt aufeinanderfolgender Bejahung und Verneinung, sofern überhaupt korrekt, lediglich als verschmitzt-rhetorische Zusammenfassung sich nach wie vor vollkommen ausschließender Bejahung(en) und Verneinung(en) anzusehen.
Ein Beispiel für Sätze, deren Zutreffen als logisch notwendig zu beurteilen ist, wäre: |Der Schreiber dieses Satzes schreibt (mindestens) manchmal Zutreffendes|
. Die Verneinung wäre, dass es nicht so sei, dass der Schreiber manchmal Zutreffendes schreibt. Dies würde bedeuten, dass er nie Zutreffendes schriebe. Da er den Satz geschrieben hat, wäre mit der Verneinung auch der Beispielsatz nicht zutreffend. Sätze im Indikativ erheben aber immer implizit den Anspruch, zutreffend zu sein (|Es ist zutreffend, dass der Schreiber dieses Satzes...|
). Verneint wäre der Beispielsatz also zugleich zutreffend und nicht zutreffend und enthielte damit einen Widerspruch. Also ist das Zutreffen des Beispielsatzes im Original als logisch notwendig zu beurteilen - auch wenn dies genau betrachtet nicht ganz voraussetzungslos ist.29
Mit der soeben durchgeführten gedankenexperimentellen Verneinung liegt schon das Beispiel für logisch unmöglich zutreffende Aussagen vor. Derweil wäre ein Beispiel für Kontingenz: |Der Schreiber dieses Satzes schreibt manchmal Unzutreffendes|
- Weder die Bejahung noch die Verneinung ergeben einen logischen (d.h. inneren) Widerspruch - auch wenn dies dem Schreiber nicht passen sollte...
Lässt sich an der Gültigkeit der Prinzipien der Logik zweifeln? Zu späterer Gelegenheit soll durchaus darauf eingegangen werden, inwieweit sich die Sinnhaftigkeit der Anwendung von Logik in Zweifel ziehen lässt, oder ob es gar ein grundsätzlicher Fehler ist, sich der Logik „als eines Werkzeugs zu bedienen, um seine Kenntnisse [...] auszubreiten und zu erweitern“30, was, wenn wir mal an den bereits festgestellten Zusammenhang zwischen den Begriffen des Erkennens und des Lernens denken, auf den ersten Blick fraglich erscheinen lassen könnte, dass Logik überhaupt ein Erkenntnisinstrument, folglich, dass sie überhaupt eine Komponente des Verstandes ist. Die Sinnhaftigkeit der Anwendung der Logik und ihr Status sind nun das eine - die Gültigkeit ihrer Prinzipien aber das andere. Was diese betrifft, so kann man diese natürlich nur bezweifeln, wenn man dazu neigt, Ja und Nein (bzw.: Wahrheit und Unwahrheit) für identisch zu halten. Ein geistig gesunder Mensch ist dazu nicht imstande.31
2.2 Empirik
Mit Logik alleine sind allerdings nicht viele Erkenntnisse zu gewinnen, denn die wenigsten Sätze, mit denen der Mensch im Laufe seines Lebens konfrontiert wird, beinhalten in sich oder in ihren Verneinungen einen logischen Widerspruch. Die allermeisten deskriptiven Sätze, die es in der Regel zu beurteilen gilt, sind logisch kontingent. Somit benötigen wir ein Urteilsvermögen, das auf die Analyse dessen, was die Logik sozusagen übriglässt, nämlich kontingente Sätze, spezialisiert ist. Dieses ist das empirische Urteilsvermögen bzw. die Empirik.
Es dürfte nicht sonderlich überraschen, dass die Methode der Empirik zunächst analog zu derjenigen der Logik verläuft, außer dass die Prüfung auf äußere Widersprüche statt auf innere Widersprüche hin erfolgt: Steht ein zu beurteilender kontingenter Satz nicht nur zu seiner Verneinung, sondern auch zu allen etablierten anderen bekannten Sätzen im Widerspruch, erscheint sein
angeblicher Sachverhalt empirisch unmöglich. Steht seine Verneinung zu ihnen im Widerspruch, erscheint sein Sachverhalt empirisch notwendig. Stehen weder er
noch seine Verneinung zu ihnen im Widerspruch, erscheint sein
Sachverhalt empirisch möglich, genauer: empirisch kontingent.
Hier drängen sich verschiedene Fragen auf: 1.) Woher kommen all jene „anderen Sätze“? 2.) Was ist, wenn der Satz einen Widerspruch zu nur einem Teil jener anderen Sätze aufweist, und seine Verneinung einen Widerspruch zu einem anderen, gleich großen Teil jener Sätze? 3.) Was ist mit einem Fall gleich dem letzteren (Nr. 2), wenn sich die besagten Teile in der Größe (oder im Gewicht) geringfügig voneinander unterscheiden? 4.) ... stark unterscheiden?
Zur Beantwortung von Frage Nr. 1 lässt sich sagen, dass sich zunächst feststellen lässt, dass die Sätze, die mindestens vorübergehend in uns entstehen, mannigfaltiger Herkunft sind: (innere und äußere) Sinneserfahrung, zu Wunschvorstellungen führende („niedere“) Neigungen wie Launen, Instinkte und Gelüste, zu harmlos-natürlichen oder auch pathologischen Wahnvorstellungen führende Ängste, das aktive Subjekt mit bewussten oder seine innere Automatik mit un(ter)bewussten rekombinativen Experimenten... manchmal ist für uns ihre Herkunft schlicht nicht identifizierbar oder in Vergessenheit geraten. An anderer Stelle wäre aber auch zu diskutieren, ob ein Teil unserer Sätze nicht angeboren oder in uns oder unseren Erkenntnisapparat von vorneherein fest eingebaut ist bzw. aus der Architektur des „Apparats“ notwendig resultiert.
Wenn wir nun annehmen, dass all diese Sätze zur Anwendung der (noch genauer darzulegenden) Methode der Empirik auf sie zunächst gleichberechtigt nebeneinander stehen, so kristallisiert sich in jedem gesunden, erwachsenen Menschen im Rahmen (und im Fall) der jahrelangen, permanenten und hinreichend konsequenten Anwendung dieser Methode heraus, dass die einzige Kategorie von im Nachhinein hinzukommenden deskriptiven Sätzen, deren Vertreter sich im Spiel des kritischen, widerspruchbasierten Ausschließens langfristig behaupten können, die Kategorie derjenigen Sätze ist, deren Quelle oder Rechtfertigung auf direkte oder indirekte Weise die Erfahrung ist.32 So besteht der Prüfstein der Empirik aus allen Erfahrungs- und allen solchen Sätzen, die beim Abgleich mit Erfahrungssätzen als wahr akzeptiert wurden. Dies wiederum bedeutet, dass jeder neue mit diesem Prüfstein geprüfte und akzeptierte Satz hierdurch selbst zu einem Bestandteil dieses Prüfsteins wird und diesen wie einen Pool erweitert.
Daher nennen wir diese Komponente des Verstandes Empirik, da sie sich mit Sätzen der Empirie, d.h. der Erfahrung, beschäftigt.
Das angesprochene Ausscheiden ganzer Satzkategorien liefert für die Rationalität übrigens nachträglich ein
Erkennungsmerkmal, durch das sich sogar die Bildung eines alternativen gültigen Begriffs von Rationalität anbietet, denn
offenbar lässt sich echte Rationalität daran erkennen, dass Urteile unabhängig von persönlichen Neigungen, Affizierungen,
Emotionen33 und Fremdeinflüssen34 gefällt werden. - Darum, zum Beispiel, nennen wir die auf eine womöglich einzige, lange zurückliegende traumatische Erfahrung zurückgehende Weigerung mancher Menschen, lange Treppen hinabzusteigen oder Brücken zu überqueren, obwohl sich seitdem diese Gebilde unzählige Male als stabil erwiesen haben, mit Recht „irrational“, und zwar selbst dann noch mit Recht, wenn sich, nach einem entsprechenden Kennenlernen der betreffenden Zusammenhänge, die irrationale Haltung für uns als „verständlich“ erweist.
Derweil führen uns die Fragen Nr. 2 bis Nr. 4 zu einem besonderen Charakteristikum der Empirik gegenüber der Logik: Während die Urteile der Logik binärer Natur sind, müssen die Urteile der Empirik einen graduellen Charakter haben. Der Grad der Aussagbarkeit eines empirischen Urteils richtet sich zunächst nach dem Verhältnis der in den obigen Fragen angesprochenen Teile. Das wiederum führt dazu, dass der Pool der Sätze, die von der Empirik zur Beurteilung herangezogen werden, selbst aus Sätzen besteht, die unterschiedliche Grade der Etabliertheit besitzen, so dass das eben erwähnte Verhältnis nicht nur von der Anzahl der Pro- und Contra-Sätze, sondern auch von ihren verschiedenen Gewichten bestimmt zu werden hat.
Darum ist die Benennung der drei Urteile der Empirik, „empirisch notwendig“, „empirisch unmöglich“ und „empirisch kontingent“ präzisierend mit Benennungen zu ersetzen, welche keine absoluten Zuschreibungen assoziieren und Verstärkungen und Relativierungen wie „sehr“, „etwas“ usw. zulassen. Dementsprechend stellen sich die drei Urteile der Empirik so dar:
- wahrscheinlich
- unwahrscheinlich
- fraglich
Das Triplett lässt sich ohne Bedeutungsänderung auch in die Form anderer Bezeichnungen gießen, z.B. „naheliegend“-„abwegig“-„ungewiss“ usw. Aufgrund der eben erwähnten Gradualität muss man sich diese Urteile als Einteilung einer kontinuierlichen Skala vorstellen, die auch in der folgenden Aufstellung je nach Zweck noch als sehr grob eingeteilt ansehen lässt:
Urteile wahrscheinlich: [völlig] sicher (100 %), hochwahrscheinlich (bis 99,9 % | ab > 88,8 %), ziemlich wahrscheinlich (bis 88,8 % | ab > 77,7 %), einigermaßen wahrscheinlich (bis 77,7 % | ab > 66,6 %).
Urteile fraglich: schwach naheliegend (bis 66,6 % | ab > 55,5 %), völlig ungewiss (bis 55,5 % | ab > 44,4 %), leicht fernliegend (bis 44,4 % | ab > 33,3 %)
Urteile unwahrscheinlich: einigermaßen abwegig (bis 33,3 % | ab > 22,2 %), abwegig (bis 22,2 % | ab > 11,1 %), extrem abwegig (bis 11,1 % | ab > 0%), [völlig] ausgeschlossen (0 %).
Zu den Charakteristika der Empirik gehört, wie festgestellt, dass ihr Prüfstein stetig wächst. Dies wirft die Frage auf, aus welchen Sätzen denn der Prüfstein ganz am Anfang, vor dem Beginn der Anwendung der Empirik, bestehe. Bevor wir vorschnell apriorische Grundsätze annehmen, nutzen wir lieber die bereits getroffene Feststellung, dass der Pool aus zwei Arten von Sätzen besteht, nämlich solchen, die direkt mit der Sinneserfahrung einhergehen, und solchen, die nur indirekt mit ihr zusammenhängen, weil solche auf derjenigen der ersten Art lediglich aufgebaut sind, bzw. von ihnen bestätigt wurden. Die Frage lautet also zunächst, wie der Übergang von Sinneswahrnehmung zum etablierten Erfahrungssatz vonstatten geht. Wenn wir uns nun selbst beobachten, stellen wir fest, dass mit unserer Sinneswahrnehmung permanent die Etablierung mindestens eines Teils unserer Erfahrungssätze einhergeht und dieser nicht das Ergebnis unseres bewussten Urteilens ist. Es handelt sich hier um diejenigen Sätze, die unmittelbar unsere Sinneswahrnehmungen repräsentieren: |Ich habe soeben Kälte auf der Haut meiner Hand gespürt|
, |Ich habe eine grüne Fläche gesehen|
, |Ich habe einen hellen Ton gehört|
, |Ich habe eine Stelle gedrückt|
35 usw. Ohne Anlass zweifeln wir an diesen Erlebnissätzen nie, d.h. wir überprüfen sie nicht, auch nicht anhand der Empirik. Permanent entstehen automatisch Erinnerungen an solche mehr oder weniger elementaren Sinneswahrnehmungen. Unter den im Laufe der Zeit hinzukommenden Sätzen sind solche sensualrepräsentativen Erinnerungen36 die erste bzw. innerste Schicht der Erfahrungssätze und somit auch des Prüfsteins.
2.2.1 Auf der Hühnerfarm
Die nächste Frage lautet natürlich, wie der Übergang von dieser zur nächsten Schicht vonstatten geht. Diese nächste und eventuelle darauf folgende Schichten bestehen logischerweise aus Sätzen, die keine Sinneswahrnehmungen repräsentierende Erlebnissätze sind, bzw. keine Erinnerungen an Sinneswahrnehmungen darstellen, sondern etwas repräsentieren, was für die Sinne nicht unbedingt zugänglich ist. - Gegeben sei nun die Situation auf einer Hühnerfarm. Ein grundsätzlich vernunftbegabter, wenn auch außerordentlich erfahrungsarmer Besucher habe nie zuvor - weder direkt noch indirekt - von Hühnern oder Eiern etwas erfahren und beobachtet, wie eine Henne ein Ei legt. Käme ihm zufällig der Gedanke: |Im Inneren des Eis befindet sich etwas Gelbes|
, müsste er, wollte er objektiv sein, das Zutreffen dieses logisch kontingenten Satzes als empirisch fraglich einstufen, denn in seinem Sätzepool befindet sich weder die Erinnerung: |Ich habe ein solches Ei geöffnet und nichts Gelbes darin gesehen|
, noch die Erinnerung: |... und etwas Gelbes darin gesehen|
, d.h. weder der Gedanke noch seine Verneinung könnten einem Widerspruch begegnen.
Nun nehme er ein Ei, das ihm daraufhin aus Versehen auf den Boden falle, so dass die zerbrochene Schale den Blick auf den gelben Dotter freigibt. Ein weiteres Huhn legt ein Ei. Ist darin ebenfalls etwas Gelbes? Soweit sich in seinem Sätzepool kein Satz findet, demzufolge gleichartige Hüllen nicht immer gleichartige Inhalte haben usw., wird der Gedanke, er werde wieder etwas Gelbes finden, keinem Widerspruch begegnen, denn er hat noch nie ein Ei geöffnet, in welchem er nichts Gelbes wahrgenommen hat. Hingegen scheint die Verneinung des Gedankens mit seiner eben gemachten Erfahrung nicht zu harmonieren: |Ich habe ein solches Ei ‚geöffnet’ und Gelbes darin gesehen|
. 100 Prozent seiner relevanten Erlebnissätze scheinen der Verneinung des Gedankens zu widersprechen.
Ist es aber überhaupt ein echter Widerspruch? Zunächst einmal nicht, denn es ist nichts Widersprüchliches darin zu sehen, im ersten Ei gelben Dotter zu finden und im zweiten Ei stattdessen eine lustige Spielfigur. Man mag hierüber aufatmen, zumal uns weitreichende Schlüsse aus einer einzigen Einzelerfahrung zu ziehen mehr als suspekt erscheint. Jedoch auch nach 1000 abweichungslos gelben Dotter aufweisenden Eiern gäbe es zwischen dieser Tatsache an sich und dem Auffinden eines blauen Schlumpfs im 1001. Ei keinen Widerspruch. Wenn die Empirik also überhaupt irgendeinen Widerspruch kennen soll, und das muss sie schon per definitionem, dann werden die Sätze, zu denen ein Widerspruch konstatiert werden kann, offenbar, aufbauend auf den wahrnehmungsrepräsentativen Sätzen der ersten Schicht, für die zweite Schicht konstruiert. Nun können wir keine anderen (oder keine so nahe kommenden) widerspruchsfähigen Sätze denken, die sich aus Wahrnehmungsrepräsentationen bilden ließen, als Verallgemeinerungen dieser Repräsentationen. Um nun rational zu sein, d.h. nicht nach Lust und Laune mal durchgeführt und mal gelassen zu werden, müssen sie von einer Regel abhängen. Hierbei müssen wir die primitivste denkbare Regel annehmen, denn sie muss schon vor aller Erfahrung zur Anwendung bereitstehen. Das geringste Maß, das die Regel an Komplexität oder Differenziertheit aufwiese, benötigte eine Rechtfertigung, zu welcher weder die Logik imstande wäre, noch die Empirik selbst, zumal diese logischerweise nicht ihre eigenen Ur-Grundlagen setzen kann. Die primitivste denkbare Regel ist trivialerweise: Zu jedem konkreten Erfahrungssatz wird eine Verallgemeinerung konstruiert.
Der Verstand unseres „unvorbelasteten“ Farmbesuchers konstruiert also vor dem Hintergrund der 100-Prozent-Lage den verallgemeinernden Satz: |Nach dem Öffnen eines frischgelegten Eis findet man darin etwas Gelbes|
. Da wir es mit Sätzen zu tun haben, die immer auch Urteile sind, lautet der Satz vollständig: |Dass man nach dem Öffnen eines frischgelegten Eis etwas Gelbes darin findet, ist völlig sicher|
. Hierzu würde der Gedanke |Dass ich nach dem Öffnen des nächsten frischgelegten Eis etwas Gelbes darin finde, ist völlig ausgeschlossen|
in der Tat im Widerspruch stehen.
Der scheinbare Haken der Methode taucht wieder auf: Die 100 Prozent können schon mit dem ersten Ei erreicht sein. Wenn nur die erste Henne ohne das Wissen des Besuchers gentechnisch verändert wäre und ein Ei ohne Eigelb gelegt hätte, lautete seine Verallgemeinerung: |Dass man nach dem Öffnen eines frischgelegten Eis etwas Gelbes darin findet, ist völlig ausgeschlossen|
.
Es mag im ersten Moment erstaunen, ja schockieren, dass hierauf der Großteil unseres deskriptiven Denkens beruht. Doch sollte man nicht vergessen, dass der Umfang des Pools flexibel ist und außerdem die Bewertung der Verallgemeinerungen als „völlig sicher“ stets nur vorläufig ist. Im Laufe der Zeit bildet die Empirik Verfeinerungen der primitiven Regel heraus, dies übrigens zunächst unter Einsatz eben derselben primitiven Regel. Erlebt der besagte Besucher der Farm dort ein sehr freches rothaariges Kind, wird er sicher zunächst denken, rothaarige Kinder seien prinzipiell frech. Wenn er bald darauf ein anderes rothaariges Kind sieht, das sehr brav ist, besitzt er einen neuen Erlebnissatz, der lautet: |Dass ich ein rothaariges braves und ein rothaariges freches Kind erlebt habe, ist sicher.|
. Die Verallgemeinerung einer noch immer recht weit am Anfang stehenden, aber korrekt arbeitenden Empirik hierzu lautet: |Dass die Hälfte aller rothaarigen Kinder brav (bzw. frech) sind, ist sicher|
, was bedeutet: |Dass ein rothaariges Kind brav (bzw. frech) ist, ist zur Hälfte sicher|
und somit |... völlig ungewiss|
.
Begegnet er bald darauf einem dritten rothaarigen Kind und erlebt es als brav, ändert sich sein Urteil abermals: |Dass zwei Drittel aller rothaarigen Kinder brav sind, ist sicher|
, was bedeutet: |Dass ein rothaariges Kind brav ist, ist zu zwei Dritteln sicher|
und somit |... einigermaßen wahrscheinlich|
.
Für uns wirkt diese Vorgehensweise nach wie vor unzuverlässig und unvernünftig. Mancher wird den Verdacht hegen, dass der Farmbesucher bei fast jeder neuen Person und jedem neuen Objekt völlig unrealistische Vorurteile über die Kategorie des Objekts und ihre übrigen Vertreter anhäufen werde und mit diesen Vorurteilen schon mangels der vermutlich meist kümmerlichen Anzahl von Kategorievertretern auch den Rest seines Lebens unvermeidlich verbringen werde. Seine konsequente Anwendung dieser Prinzipien der Empirik vorausgesetzt, ist dem jedoch keineswegs so, denn zu seiner Sinneswahrnehmung gehört ja auch die innere Wahrnehmung (Introspektion) und somit die Wahrnehmung seines eigenen Urteilens und seines Sätzepools. Schon seine Erfahrung mit dem zweiten rothaarigen Kind, die von der Erfahrung mit dem ersten abwich, erzeugt den Erfahrungssatz: |Dass das Urteilen aufgrund nur des ersten Exemplars einer Kategorie nie völlig sicher ist, ist völlig sicher|
. In der weiteren Entwicklung wird auch der Wiederholung eines ersten gemeinsamen Auftretens zweier beliebiger Phänomene prinzipiell Ungewissheit beigemessen, in einer weiteren Phase wird auch hier differenziert, und irgendwann bildet sich als Grundsatz auch das Prinzip der höhergradigen Form von Induktion heraus, welches sich übrigens in diesem Lichte, entgegen der naheliegenden Annahme, als nicht-apriorisch37 erweist: |Je häufiger sich etwas unter bestimmten Umständen wiederholt hat und je weniger Ausnahmen hiervon bekannt sind, desto wahrscheinlicher ist sein erneutes Auftreten, wenn die genannten Umstände sich erneut ergeben|
.38 39 Auch dieses erfährt irgendwann Differenzierungen, z.B. je nach dem, ob gerade Belebtes oder Unbelebtes betrachtet wird, und je nach Art des Belebten oder Unbelebten etc. - Solche Sätze, d.h. Sätze, die das Urteilen zum Gegenstand haben, legen sich als dritte Schicht des Prüfsteins über seine zwei anderen Schichten. Diese dritte Schicht ist es denn auch, in welcher sich in fortgeschrittener Empirik Sätze etablieren wie, dass Sätze mit Wunschdenken, Affizierungen, Launen, Instinkten oder Gelüsten etc. als bloßem Ursprung ohne Weiteres haltlos sind.
So vergrößert sich der Prüfstein der Empirik nicht nur immer weiter, sondern verfeinert sich sukzessive und wird immer komplexer und differenzierter. Empirik ist also ein autoregulatives System, und im Laufe der Zeit kristallisiert sich - sozusagen in natürlicher Auslese - eine Reihe von stabilen Grundsätzen heraus, die für jede ausgereifte Empirik konstitutiv sind.
Da die Beschränkung auf die Kernempirik sichtbarerweise mit einem recht unbrauchbaren Intellekt einhergehen würde, ist es sinnvoll, die Empirik erst in ihrer voll ausgereiften Form zur Triade des menschlichen Urteilsvermögens zu rechnen - ohne allerdings zu vergessen, in welchen Ursprüngen und Grundlagen ausgereifte Empirik wurzelt. In den ihren Bereich betreffenden Zusammenhängen, in denen die nachträglich herausgebildeten Grundsätze nicht anwendbar sind, kommt sie denn zwangsläufig wieder in ihrer Rohform zum Einsatz (Fallbackverfahren). Dies ist beispielsweise der Fall, wenn unsereiner praktisch bei jedem menschlichen Gegenüber davon ausgeht, dieses besitze ein Bewusstsein, obwohl er in seiner persönlichen Erfahrung nur ein einziges Exemplar jemals als Bewusstsein besitzend erlebt hat, nämlich sich selbst.
2.3 Ethik
Die wohl am meisten ignorierte und unterschätzte Komponente der menschlichen Vernunft, die außerdem von den meisten Menschen gar nicht erst zu ihr gezählt wird, obwohl sie zweifellos zu ihr gehört, ja sogar das Oberhaupt der rationalen Triade ist, ist das ethische Urteilsvermögen. Weitere Namen, die sich als Bezeichnungen für das ethische Erkenntnisvermögen in Erwägung ziehen lassen (oder kraft des kollektiven Unterbewusstseins sogar schon eingebürgert haben) sind: Gewissen, Herz, sittliche Ratio, praktische Vernunft, sittlicher Intellekt.
Der Anwendungsbereich der Ethik ist per definitionem die Untersuchung normativer Sätze. Das sagt noch nichts bzw. nicht direkt etwas darüber, welche grundsätzliche Abgleichsmethode die Ethik anwendet, um die Wahrheit eines normativen Satzes zu erkennen.
2.3.1 Zum Wesen normativer Sätze
Zunächst einmal ist das Wesen des normativen Satzes zu klären, bzw. worin er sich vom deskriptiven Satz essentiell unterscheidet. Deskriptive Sätze sind so aufgebaut, dass, wenn wir sie akzeptieren, wir zugleich annehmen, dass sie etwas, dem Tatsächlichkeit bzw. Faktizität (von der wir einen Elementarbegriff haben) zukommt, akkurat „abbilden“. Wir sagen darum, dass sie auf die Wirklichkeit oder ein Faktum zutreffen. Sätze mit dieser angenommenen Eigenschaft sind das Ziel alles deskriptiven Räsonierens. So einwandfrei eine logische oder empirische Beweisführung und so hoch oder vollkommen die Notwendigkeit, die sie dem Zutreffen eines Satzes zuordnet, sein mögen – wenn wir aus irgendeinem Grund davon ausgehen müssten (so schwer das vorstellbar ist), dass der Satz kein Faktum abbildet, würden wir jene Notwendigkeit ignorieren und ihn verwerfen. Das Maß ist hier von der Intention her das Faktum und wird nur im Falle seiner fehlenden direkten Zugänglichkeit aufgrund dieses Fehlens mit epistemischen Korrelaten als stellvertretender Prüfstein ersetzt. Gemäß der zwischen deklarativen und imperativen Sätzen herrschenden Dichotomie des Gesetztwerdens und Setzens verhält es sich bei normativen Sätzen umgekehrt dazu: Ein normativer Satz ist so aufgebaut, dass nicht er am Faktum, sondern das (gedachte oder echte) Faktum an ihm gemessen wird. Während die objektive Akzeptabilität eines deskriptiven Satzes davon abhängt, dass er auf die Realität zutrifft, hängt nun also die objektive Akzeptabilität der (aktionalen) Realität davon ab, dass sie auf den normativen Satz zutrifft. Ist dies nicht der Fall und hat zuvor das vollkommen rationale Subjekt den normativen Satz akzeptiert und verinnerlicht, verwirft es die (potentielle oder aktuale) Realität. Während das Verwerfen eines deskriptiven Satzes darin besteht, sich seiner Konstruktion und Speicherung zu enthalten, besteht das Verwerfen einer potentiellen oder aktualen Realität darin, ihre Herbeiführung zu unterlassen, diese zu verhindern und/oder ihre Rückgängigmachung anzugehen.
Sätze, an deren Struktur man diese maßstabhafte Funktion erkennt, und die hierin von den abbildenden Sätzen unterscheidbar sind, kennen wir sprachlich als Sollen- bzw. Müssen-Sätze, also Sätze z.B. der Form „X soll sein“ oder „X muss sein“. Da die Verben des Sollens und Müssens mehrdeutig sind und z.B. nicht das natural-kompulsive Müssen gemeint ist, ist in der Regel die folgende Form vorzuziehen: |X ist <Urteilsbegriff>|
, wobei <Urteilsbegriff> einer der folgenden drei komplementären Begriffe ist:
- obligat („ethisch notwendig“)
- verwerflich („ethisch unmöglich“)
- indifferent („ethisch kontingent“)40
Solche Sätze sind auf der rein intellektuellen Ebene die einzigen, die direkt von imperativen Satzkonstrukten vertreten werden können, oder diejenigen, die am direktesten von Imperativkonstrukten vertreten werden können. Das äußert sich darin, dass sich aus keinem deskriptiven Satz, aber aus jedem normativen Satz direkt ein Imperativ folgern lässt: Eine grundsätzliche und allgemeingültige Folgerung A ist B, also tue X!
ist ohne Weiteres offensichtlich völlig unnachvollziehbar; hingegen wird jeder die Folgerichtigkeit der trivialen Verknüpfung X zu tun ist obligat, also tue X!
ohne Weiteres erkennen, obwohl die beiden verknüpften Sätze nicht miteinander identisch und zudem sehr verschiedenartig sind. Wenn uns also Konstrukte wie im ersten Folgerungsmuster folgerichtig scheinen, wie z.B. Der Stift schreibt nicht mehr, also wirf ihn weg!
, dann ist der normative Satz lediglich sprachlich unsichtbar, und doch ist er es und nicht der deskriptive Satz, auf dem der Imperativ beruht. Unausgesprochen und der unterbewussten Assoziation überlassen ist hier gar ein ganzer syllogistischer Zusammenhang41, der normative Sätze einbindet, von denen nicht jeder es ist, auf welchem der Imperativ direkt beruht, aber auf jeden (von Irrationalität freien) Fall derjenige, der besagt: Dass du ihn wegwirfst, ist obligat.
Ohne normative Vorannahme(n) bzw. nach ihrer Neutralisierung wirkt die Folgerung sinnlos bzw. unsinnig: Funktionslose Stifte zu behalten oder wegzuwerfen, ist in jedem Fall indifferent, und dieser Stift ist funktionslos. Also wirf ihn weg!
42 Jeder normative Satz und nur ein solcher kann also einen Imperativ direkt begründen und hierdurch von einem imperativen Satz direkt vertreten werden.
Was aber ist der Grund dafür, dass Imperativsätze so gut zu normativen Sätzen passen, obwohl sie voneinander verschieden sind (sonst könnten sie in keiner trivialen Folgerung aufeinander aufbauen), nicht aber zu deskriptiven Sätzen? Und wieso ist die umgekehrte Richtung („Tue X, also ist X zu tun obligat.“) nie möglich? Diese Unmöglichkeit spricht übrigens als weiterer Punkt für ihre signifikante Verschiedenheit voneinander, allerdings ohne dass diese Verschiedenheit alleine als Erklärung der Unmöglichkeit hinreicht. Am besten lässt es sich wohl erklären, indem man Imperative nicht als Korrelate oder direkte Korrelatträger, sondern als Akte auffasst43.
So wie ein gültiger deskriptiver Satz einem Faktum folgt und nicht umgekehrt, und seine Gültigkeit letztlich von seiner Übereinstimmung mit dem Faktum abhängig ist und nicht umgekehrt, so folgt ein gültiges Faktum einem normativen Satz und nicht umgekehrt, und ist seine Gültigkeit von seiner Übereinstimmung mit dem normativen Satz abhängig und nicht umgekehrt. Der Imperativ, als Akt aufgefasst, ist offensichtlich nichts als die Initiierung der Herstellung eines (i.d.R. aktionalen) Faktums und in dieser Funktion ein Teil desselben. Hierdurch folgt er dem normativen Satz wie der Rest des Faktums, und ist seine Gültigkeit genau so vom normativen Satz abhängig, wie die Gültigkeit des restlichen Faktums von ihm abhängig ist, was zusammengenommen bedeutet, dass er aus dem normativen Satz in der gleichen Weise folgt.
2.3.2 Was ist der eigentliche Untersuchungsgegenstand?
Angesichts dieser Sachlage könnte nun jemand auf die Idee kommen, anzunehmen, dass das ethische Urteilsvermögen keine normativen Sätze zum typischen Untersuchungsgegenstand haben sollte, sondern aktuale oder potentielle Fakten oder eben die Realität, also bloß das, was potentiell zutrifft, was beim deskriptiven Urteilen der deskriptive Satz und hier das Faktum ist. Während sich das ethische Urteilsvermögen vergleichend und differenzierend mit bloßen Fakten auseinandersetzt, könnte das maßstabhafte Ideal, das aus den normativen Sätzen besteht, also sozusagen der „normative Geist“, ja genauso in einer gewissen Verborgenheit liegen wie die „Realität an sich“ des deskriptiven Urteilsvermögens. Dass das einen Untersuchungsvorgang jeweils abschließende ethische Urteil das Übereinstimmen oder Abweichen des Faktums von jenem nicht direkt erkennbaren „Gesetz“ akkurat repräsentiert, wäre genauso letztlich bis zu einem gewissen Grad sozusagen eine Vertrauenssache, wie es in umgekehrter Richtung beim deskriptiven Urteilen der Fall ist. Auch für die Frage, ob eine Handlung, in welcher das jeweilige potentielle oder aktuale Faktum bestünde, auf innere oder aber auf äußere Widersprüche mit anderen Handlungen zu untersuchen wäre, was ja zunächst aufgrund der fehlenden vom deskriptiven Intellekt bekannten Dichotomie (Logik und Empirik) unklar ist, gäbe es eine Antwort: Theoretisch könnte man alle potentiellen Handlungsfakten auf innere Widersprüche untersuchen, um im Fall eines solchen Widerspruchs ihre (vordergründige) Verwerflichkeit und die Obliganz44 ihrer Negation festzustellen (hierbei müsste wohl der involvierte Willensentschluss als Mitkonstituente eines aktionalen und hierdurch relevanten Faktums berücksichtigt werden, wie z.B. in Kants Lehre), so dass sich hierdurch eine Untermenge „gültiger Fakten“ herauskristallisiert, die vielleicht als Prüfstein zur empirikanalogen Untersuchung der übrigen potentiellen Fakten referenziert werden könnte.
So verlockend dieser Gedanke sein mag, so wenig zielführend ist er jedoch (abgesehen davon, dass er einem relativ primitiven und gewagten Analogieschluss zwischen zwei sehr verschiedenen Bereichen der Erkenntnis entspringt und zudem unserer Definition des ethischen Urteilsvermögens als dasjenige, was normative Sätze zum Untersuchungsgegenstand hat oder wenigstens als Instrument seiner Untersuchungen einsetzt, widerspricht). Denn aktuale Fakten (seien es aktionale oder sonstige) können sich als Fakten gar nicht widersprechen, weder ein Faktum sich selbst, noch eines mit anderen Fakten, denn dann wären sie keine Fakten. Und die Untersuchung potentieller Fakten auf innere oder äußere Widersprüche untereinander ist bereits das Geschäft von Logik und Empirik (zumal deskriptive Sätze nichts anderes als potentielle Fakten sind) und führt allenfalls zur Erweiterung der Kenntnis wiederum des Reichs der Fakten, nicht aber des normativen Geistes, dessen Identifizierung mit dem Faktenreich offensichtlich unsinnig wäre. Selbst unter der dezidierten Bedingung, dass nur solche deskriptiven Sätze verglichen werden, in denen der Wille eine Rolle spielt, sofern dieser als rein kausaler Faktor aufgefasst wird, ist nicht zu sehen, wie Widersprüche unter ihnen zu etwas anderem als zu genuin deskriptiven Urteilen führen sollen.45 Auch schon praktisch wäre das Unterfangen schier unmöglich, alle potentiellen Handlungsfakten zu durchforsten, um sie auf innere Widersprüche zu untersuchen.
2.3.3 Erster Anlauf zur Rekonstruktion des normativen Geistes
So
bleibt nichts anderes übrig, als vom Reich der potentiellen und
aktualen Fakten als Untersuchungsgegenstand bis zur Auffindung des
Maßstabs abzusehen und den normativen Geist anhand seiner selbst
zu erschließen, d.h. unter seinen Sätzen eine selbstevidente bzw. a
priori gültige Kernteilmenge zu suchen, so dass die zum Abgleichsmaßstab
für alle übrigen potentiellen Elemente des normativen Geistes dienen
kann. Höchstens erst nach dem Feststehen der Gesamtheit der jeweils
relevanten gültigen normativen Sätze sind wir überhaupt in der Lage,
Fakten, ob potentielle oder aktuale, zu beurteilen, nämlich dann durch
einfachen Abgleich mit den feststehenden normativen Sätzen (und nicht
mit sich selbst oder anderen Fakten). Jenen Kern zu finden dürfte,
anders als bei Fakten mit ihren unendlichen Kombinationsmöglichkeiten in
ihrer Form „X ist/hat Y“, bei normativen Sätzen viel besser möglich
sein, zumal im Verhältnis dazu die Menge der Möglichkeiten, einen
inneren Widerspruch im Satz oder seiner Negation aufzuweisen, bei der
Form |X ist obligat/verwerflich/indifferent|
offensichtlich nur
einen winzigen Bruchteil jener Menge darstellen wird. X muss einfach den
Urteilsbegriff |obligat| oder den Urteilsbegriff |verwerflich| a priori
enthalten.
Am offensichtlichsten ist dies der Fall, wenn X mit dem Urteilsbegriff – ganz trivial – weitestgehend identisch ist: |Obligates ist obligat|
, |Verwerfliches ist verwerflich|
.
Naheliegend ist hier der Einwand, man könne mit diesen Sätzen nichts
anfangen, weil sie Tautologien darstellten und in dieser Eigenschaft
keinen Prüfstein für irgendetwas abgeben könnten. Der Einwand würde aber
übersehen, dass das Prinzip, auf das er sich beruft, dem Bereich des
konspektiven Denkens und somit der Auseinandersetzung mit deskriptiven Sätzen entnommen ist, und es keinen Beweis dafür gibt, dass er im Bereich des rein ethischen Denkens und somit auch für normative Sätze gelten kann. Es ist richtig, dass tautologische Beschreibungen
nicht weiter bringen; doch die Zuordnung von Obliganz oder
Verwerflichkeit ist gar keine Beschreibung, keine Mitteilung oder Nachzeichnung einer
Erfahrung, sondern ein reines, wertendes Urteil a priori. Mit einem deskriptiven Satz endet ein Denkprozess, mit einem normativen Satz beginnt er (im Idealfall).
Freilich lässt ein sprachlicher Faktor, nämlich die indikative Ist-Verknüpfung, welche ein deklaratives
Sprachkonstrukt herstellt, den normativen Satz deskriptiv aussehen.
Davon sind, so sehr es manchen überraschen mag, strenggenommen auch
Sollen-Satzkonstrukte betroffen, sofern diese inhaltsgleich sind,46
da auch sie ein Prädikat beinhalten, das in dieser Hinsicht nichts
Anderes bewirkt. Jedes Verb bedeutet ein (allgemeines oder spezielles)
Sein, so dass der Indikativ den Sollen-Satz lediglich zu einem
speziellen Ist-Satz macht. Auch auf der intentionalen, kognitiven Ebene
lässt sich dafür eine zweifelsfreie Bestätigung finden: Mit einem Satz
in der obigen Form wollen wir vielleicht jemanden dazu bringen, eine
bestimmte Sache zu tun oder zu lassen, doch beabsichtigen wir
offensichtlich, dies zu bewerkstelligen, indem wir ihn glauben machen wollen, dass X das Urteil tatsächlich
zukommt, weil wir meinen oder hoffen, dass er sein Verhalten vielleicht
auf eine solche Art von vorgeblichen Fakten gründet. – Dies ist jedoch
kein Grund, den normativen Satz grundsätzlich als bloße Subkategorie des
deskriptiven Satzes zu marginalisieren und normative Sätze als von
derjenigen des deskriptiven Satzes unabhängig existierende,
eigenständige Kategorie von Sätzen zu verleugnen.
2.3.4 Funktion und Effekt der Deskriptivierung
Vielmehr sollte es nicht verwundern, dass sich zu jedem normativen Satz (der vom imperativen Sprachkonstrukt nur uneindeutig repräsentiert wird, wobei andererseits auch die Eindeutigkeit deskriptiver Formen für Faktuales mal dahingestellt sei) ein deskriptiver Satz konstruieren lässt, zumal nichts dagegen spricht, dass wie der Zweck eines solchen ist, einen realen Gegenstand (z.B. eine vorliegende Mütze) zu beschreiben (z.B. als ledern), er auch geeignet ist, einen ideellen Gegenstand (z.B. die Idee der Primzahl oder eine nur erhoffte Umarmung) zu beschreiben, und nichts dagegen spricht, dass ein solcher ideeller Gegenstand letztlich in einem bloßen, non-assertorischen und somit in gewisser Hinsicht simplen Begriff besteht. Es ist lediglich der Fall, dass wir einen solchen, sofern er ein Handlungsbegriff ist und auf seiner Hauptebene jenseits von Beliebigkeit und Willkür die Instanz eines normativen Urteilsbegriffs aufnimmt (und dadurch zu einem sogenannten thick concept wird), einen subjektiven normativen Satz oder ein ethisches Korrelat nennen. Ein deskriptiver Satz kann dann in Bezug auf einen solchen „aufgeladenen“ Handlungsbegriff insbesondere als das epistemische Resultat eines geistigen Auges Betrachtung gelten, analog dazu, dass er in Bezug auf empirische Objekte als das Resultat eines sinnlichen Auges Betrachtung gilt. Eingeräumt sei, dass ein diesen Begriff beschreibender deskriptiver Satz strenggenommen (bzw. oberflächlich betrachtet) kein normativer Satz ist, sondern die faktizistische Einhüllung eines solchen. In der Einhüllung schlägt sich aber lediglich die Annahme nieder, dass die betrachtete begriffliche „Realität“ genauso objektiv wie eine äußere Realität sei, mithin, dass der jeweilige Handlungsbegriff in jedem ideal verfassten Intellekt mit dem von dem Satz prädizierten Werturteil notwendig (aber nicht unbedingt assertorisch) einhergehen würde. Der normative Satz ist gleichwohl im Inneren der Hülle enthalten und das für uns Wesentliche an dieser speziellen Art von deskriptiven Sätzen, so dass diese nach ihm benannt werden und den übrigen deskriptiven Sätzen dichotomisch gegenübergestellt werden können.47 48 Darum seien fortan mindestens im Zusammenhang einer solchen Gegenüberstellung, wenn dieser nichts anderes festlegt, mit „deskriptiven Sätzen“ alle Faktualkorrelate abzüglich solcher gemeint, die lediglich Umhüllungen ethischer Korrelate sind, so dass ihnen letztere vollständig gegenüberstehen.
Eine eher nebensächliche Frage ist, wie sich im menschlichen Geist ein ethisches Korrelat ohne seine faktualisierende Einhüllung, wenn diese in Bezug auf ethische Korrelate ein bloß fakultatives Konstrukt ist, so etablieren kann, dass sich zwischen den bloß gedankenexperimentellen und den tatsächlichen, stabilen Werturteilen des Subjekts im Nachhinein und langfristig unterscheiden lässt. Dies zu beantworten hätte überwiegend lediglich den Nutzen, die „Ehre“ der normativen Sätze als nicht zwingend und in jeder Hinsicht eine bloße Subkategorie des deskriptiven Satzes darstellend zu „retten“, indem gezeigt wird, dass sie sich im Geist auch anders als im Zuge einer Faktualauszeichnung in irgendeinem relevanten Sinn etablieren können. Darum begnügen wir uns bei dieser Fragestellung hier mit dem Hinweis, dass sie andernorts hinreichend ausführlich erörtert wird.49 Jedenfalls lässt sich getrost feststellen: Einen Grund gibt es weder zur Annahme noch zur Forderung, dass es in der Ethik ein Analogon zur Faktualauszeichnung (S) des konspektiven Intellekts gibt außer dem fundamentalen Urteilsbegriff selbst. - Die grundsätzliche Nebensächlichkeit der Frage, die einem wenig relevanten Übergangsbereich zwischen Erkenntnistheorie und Metaphysik angehört, dürfte aber evident sein, denn Normativität stiftende Prädikate (thin concepts) sind so offensichtlich anders als alle Prädikate, die in genuin, also das Reale oder seine Strukturen oder seine Kategorien und potentiellen Varianten beschreibend deskriptiven Sätzen vorkommen können, dass, wenn Sätze nicht in deskriptive und normative sauber unterteilbar wären, so doch eine Unterteilung in genuin deskriptive und normativ deskriptive vorzunehmen wäre, was im Prinzip auf dasselbe hinausliefe.
2.3.5 Prüfmittel und -methode des normativen Satzes
Mit
welcher Methode wird ein normativer Satz (verglichen mit den Methoden
der Logik und der Empirik) richtigerweise überprüft? – Für die Methode
der Untersuchung auf innere Widersprüche spricht, dass das Faktum,
welches das deskriptive Format eines solchen Satzes typischerweise
repräsentiert, kein empirisches ist. Ein Satz |X zu tun ist verwerflich|
kann allerdings weder so noch negiert direkt einen inneren Widerspruch
offenbaren. Falls X selbst in sich widersprüchlich sein sollte (z.B.
„regungslos rennen“), ist der Satz sowohl so als auch negiert einfach
nur sinnlos bzw. als epistemisches Korrelat gar nicht erst
konstruierbar. Doch bevor wir diese Untersuchungsmethode für normative
Sätze gänzlich verwerfen, sollten wir in Betracht ziehen, sie auf seine
subjektbasierte Interpretation anzuwenden: Ein über die
urteilsrelevanten Gegebenheiten hinreichend informiertes Subjekt mit
idealem, intaktem und ausgereiftem Intellekt würde bei Unbeeinflusstheit
von sonstigen Faktoren X zu tun grundsätzlich verwerfen.
Hier
scheint nun ein relevanter logischer Widerspruch denkbar: Wenn ein
intakter, ausgereifter Intellekt grundsätzlich ein ethisches Korrelat
enthält, in welchem die Verwerfung von X durch das Subjekt besteht,
würde sich die Negation (S) des Satzes
innerlich widersprechen, denn sie würde lauten, dass der Intellekt eines
Subjekts mit einem X verwerfenden Intellekt X nicht verwerfen würde.
Jedoch wäre diese Feststellung nicht voraussetzungslos: Sie hinge davon
ab, dass ein intakter und ausgereifter Intellekt zu X grundsätzlich eine
verwerfende Haltung enthält, obwohl doch gerade das der Gegenstand der
Prüfung und somit ungewiss ist. Die Untersuchungsmethode des logischen
Urteilsvermögens allein bringt uns also bei der Prüfung normativer Sätze
tatsächlich nicht weiter.50
Die Untersuchung auf
äußere Widersprüche, also der Abgleich mit anderen Sätzen als dem zu
prüfenden Satz und seiner Negation, wie es vom empirikbasierten
Verfahren bekannt ist, ist somit die einzig noch verbleibende Option.
Doch welche Sätze sollen das sein? Eine widerspruchsfreie Quelle von
Basissätzen wie in der Empirik, die von den Sinnen mit Material für die
innerste Schicht ihres Pools beliefert wird, hat das ethische
Erkenntnisvermögen nicht, auch wenn es tagtäglich mit immer neuen
Imperativen und normativen Behauptungen konfrontiert werden mag, denn
diese können sich, anders als unmittelbare Erlebniseindrücke (ein und
derselben Person) und die sie repräsentierenden Korrelate, widersprechen
und tun dies auch. Wenn die introspektive und extrospektive empirische
Realität als Quelle normativer Prüfsätze ausscheidet, also alles
Aposteriorische, bleibt für die Lokalisierung der normativen Prüfmittel
nur noch das apriorisch im Intellekt enthaltene. Nachdem die
subjektbasierte Interpretation deskriptivierter normativer Sätze in
Bezug auf die Gültigkeit der Untersuchung solcher Sätze auf innere
Widersprüche nichts beitrug, birgt sie hier zum Thema der Untersuchung
auf äußere Widersprüche einen Ansatz zur Auffindung des dazu benötigten
Prüfmittels. Wir könnten uns hierfür nämlich fragen: Was ist der
kleinste gemeinsame Nenner an normativen Sätzen, der in allen intakten
Intellekten angelegt ist, so dass diesem jede Vernunft zustimmen muss?
Da normative Sätze stets die Form |X ist obligat/verwerflich/indifferent|
haben, brauchen wir uns keine besonderen Hoffnungen zu machen, dass die voraussetzungslos apriorischen und intrinsisch evidenten unter ihnen mehr sind als die Sätze |Obligates ist obligat|
, |Verwerfliches ist verwerflich|
und |Indifferentes ist indifferent|
,
die, zumal ihre Begriffe allesamt als Negationen voneinander
(re-)konstruierbar sind, vielleicht sogar auf einen einzigen der drei
Sätze zurückgehen, sei dieser nun |Obligates ist obligat|
oder |Verwerfliches ist verwerflich|
.
Die
beiden für die weiter oben begonnene Rekonstruktion des normativen
Geistes nun wesentlichen Fragen, von denen sich die zweite von ihnen
durch die erste beantwortet, lauten: 1.) Wie können die bisher
gefundenen sicheren, objektiven normativen Sätze trotz ihrer scheinbaren
Tautologie als Prüfmaßstab für andere normative Sätze fungieren? 2.) In
welchen weiteren Sätzen besteht der Rest des normativen Geistes?
Zur
Beantwortung der ersten der beiden Fragen ist auf eine vorher zu
stellende Frage einzugehen: Wie kann ein normativer Satz allgemein als
Prüfmaßstab für andere normative Sätze fungieren, bzw. was macht ihn
dazu geeignet? Universell nachvollziehbar beruht diese Eigenschaft
darauf, dass ein normativer Satz als Begründungssatz für andere
normative Sätze dient, indem ihre Negationen im Widerspruch zu ihm
stehen. Z.B. steht |Töten eines unschuldigen Menschen ist obligat/indifferent|
im Widerspruch zu |Menschenleben zu bewahren ist obligat|
, so dass dies die Begründung ist für: |Töten eines unschuldigen Menschen ist verwerflich|
Das legt nahe, dass dies auch bei den oben gefundenen Sätzen der Fall
ist, und außerdem, dass alle gültigen normativen Sätze in Form von in
den oben gefundenen Sätzen mündenden Begründungsketten auf sie
zurückgehen. Beispielsweise lässt sich mit dem Satz |Verwerfliches ist verwerflich|
begründen: |Sich mit Drogen zu berauschen ist verwerflich|
. Denn die Negation hiervon, bzw. dem zuwiderzuhandeln, widerspräche dem Satz: |Die Aufrechterhaltung der eigenen Selbstkontrolle ist obligat|
51, und diesem zuwiderzuhandeln, widerspräche wiederum dem Satz: |Die Aufrechterhaltung der eigenen Fähigkeit, sich vor der Begehung von Verwerflichem in Acht zu nehmen, ist obligat|
, und diesem zuwiderzuhandeln, widerspräche dem Satz: |Sich in Acht zu nehmen vor der Begehung von Verwerflichem ist obligat|
, und diesem zuwiderzuhandeln (per willentlicher Unterlassung), widerspräche dem Satz: |Zu riskieren, Verwerfliches zu tun, ist verwerflich|
, und diesem zuwiderzuhandeln, wäre eine Begehung des Verwerflichen im Maße des Risikos und widerspräche daher dem Satz: |Verwerfliches zu tun ist verwerflich|
, für den sich als letzte Begründung an dieser Stelle nur noch anführen lässt: |Verwerfliches ist verwerflich|
.
Und diese Begründung ist tatsächlich universell nachvollziehbar: Wäre
Verwerfliches nicht verwerflich, wäre Verwerfliches zu tun nicht
verwerflich, usw. .
Ein Einwand, demzufolge mit der Unterlassung
der Inachtnahme gar kein Risiko der Begehung von Verwerflichem
einhergehe, weil es außerhalb dieser Begründungskette nichts
Verwerfliches gebe, wäre ungültig. Denn es lassen sich Beispiele für
außerhalb dieser Begründungskette stehende Verwerflichkeiten anführen –
und schon eine genügt – nämlich das Gleichsetzen von Obligatem und Verwerflichem.
Seine Verwerflichkeit kann unmöglich geleugnet werden, und für die
Gültigkeit ihrer Feststellung ist eine sonstige Existenz von Obligatem
und Verwerflichem nicht erforderlich, denn selbst in Absehung von ihrer
Existenz oder Nichtexistenz wäre die Tat möglich und eine
Verwerflichkeit (S), zumal sich der
betreffende Akteur ihre Existenz ja einbilden kann (Die Einbildung würde
ihn von seiner Schuld nicht freisprechen, denn ausschlaggebend ist
seine Intention, und dass er vom Obligaten und Verwerflichen einen
Begriff hat.). Und da es schon genügen würde, wenn das Verwerfliche
außerhalb des bloß bis zu dem Risiko-Satz gehenden Teils der
Begründungskette existierte, ist ein weiteres Beispiel aus dem gleichen
Grund die Begehung von Verwerflichem. Folglich existiert52
Verwerfliches (und damit auch Obligates). - Im Übrigen hätte der
Einwand mit der folgenden Übersetzung der Begründungskette in die Angabe
des ihr zugrundeliegenden Vorgangs im Individuum nicht einmal seinen
Anschein der Notwendigkeit: Der bloße Gedanke an Verwerflichkeit,
abseits jeglicher natürlichen oder kommunizierten Verheißung oder
Drohung, erzeugt oder erneuert im einwandfrei intellektbegabten,
unbeeinflussten Individuum eine Reihe von Bereitschaften und
Willensentschlüssen, darunter den Willen, sich von Verwerflichem, was
auch immer es sein mag, fernzuhalten. Und das ist das, was auf der
individuellen und subjektiven Ebene einer derartigen Kette von
normativen Sätzen des deskriptiven Formats zugrunde liegt, nämlich dass
das Subjekt beim „Anblick“ des Begriffs des Obligaten bzw. des
Verwerflichen oder spätestens bei der praktischen Auseinandersetzung mit
ihm zumindest im Zustand der Unbeeinflusstheit von Neigungen
unvermeidlich ein praktisch wirksames thick concept konstruiert, und beim „Anblick“ desselben ein weiteres thick concept (oder mehrere zugleich) usw.
Die
Eignung jedes normativen Satzes, als Begründung eines anderen zu
fungieren, lässt sich auch als seine Eignung betrachten, normative Sätze
zu produzieren. In unserem Beispiel von eben lässt sich nachvollziehen,
wie der Satz |Verwerfliches ist verwerflich|
so gesehen mehrere normative Sätze produziert, einschließlich des Satzes |Sich mit Drogen zu berauschen ist verwerflich|
. Weiteres Beispiel: |Obligates ist obligat|
=> |Obligates zu tun ist obligat|
=> |Die Aufrechterhaltung der eigenen Fähigkeit, Obligates zu tun, ist obligat|
=> |Eine gesunde Lebensführung ist obligat|
.
Somit liegt eine Antwort auf die erste unserer beiden Fragen vor, und
zugleich auch zumindest ein Teil der Beantwortung der zweiten Frage und
eine Perspektive für die restliche Beantwortung. Es dürfte klar sein,
dass ihre vollständige Beantwortung den Rahmen völlig sprengen würde.
2.3.6 Der Nukleus der sittlichen Ratio
Wenngleich nun |Obligates ist obligat|
und |Verwerfliches ist verwerflich|
nach dem bisher Gesagten den Anschein besitzen, die Ursätze des
ethischen Urteilsvermögens zu sein, aus denen der gesamte normative
Geist erwächst, sind wir bei seiner und seines Urkeimes Erschließung
noch nicht unbedingt am Ende angelangt. Zuvor muss nämlich
sichergestellt werden, dass der Urteilsbegriff elementar ist
(nicht oder nicht nennenswert zerlegbar). Ist er dies nicht, ist
womöglich nur ein Teil von ihm dasjenige, dem jene essentielle
Produktivität zueigen ist, während er selber durch den zusätzlichen Teil
so spezifiziert und somit eingeschränkt ist, dass nur ein Teil des
normativen Geistes aus seinen Sätzen folgt und ein anderer Teil
unsichtbar bleibt. (Ebenso ausgeschlossen werden müssen unbegriffliche,
rein linguistische Spezifizitäten, welche den Blick auf den Gehalt der
involvierten urteilsbegrifflichen Ausdrücke verfälschen oder
versperren.) Dass den Begriffen des Obligaten und des Verwerflichen,
obwohl sie durchaus gültige Urteilsbegriffe abgeben, ein noch
fundamentalerer zugrundeliegen oder für eine unbehinderte
abstraktiv-dialektische Handhabung ihren Ausdrücken wenigstens
Alternativen beigestellt werden müssen, sollte anhand der Tatsache klar
werden, dass sie offensichtlich handlungsspezifisch sind, d.h.
ihre Gegenstände ausschließlich Handlungskategorien sein können. Was
hier zunächst nicht wundernimmt, zumal die Resultate ethischer
Reflexionen zumeist rein praxisrelevant sind bzw. ihr Zweck es ist,
Orientierung in Bezug auf die Praxis zu erlangen, erweist sich als
Problem, wenn man bedenkt, dass es keinen Beweis gibt, dass Urteile, die
zu jenen Resultaten hinführen, grundsätzlich und unbedingt handlungsbezogen sein müssen. Im Gegenteil: Oft ist es etwas Non-Aktionales, dessen Rang
die Erforderlichkeit oder Verwerflichkeit eines bestimmten Verhaltens
begründet (je nach dem, was für ein objektiver Rang einer Sache wie z.B. Leben oder
Nation o.a. zukommt, ist seine Beschützung eine große, eine kleine oder
gar keine Pflicht). Es steht sogar a priori fest, dass jede objektive
Pflicht (jedes Obligate) eine Grundlage für ihr Pflichtsein (ihre
Obliganz) benötigt und diese vordergründig in einer übergeordneten
anderen Pflicht, letztlich aber eben in keiner Pflicht, sondern in einem objektiven Wert bestehen muss, bzw. in einer Würdigkeit,
die (zusätzlich) etwas anderem als der Pflicht selbst zukommt. Eine
vermeintliche Pflicht, der gar nichts zugrunde liegt, das wenigstens ein
winzigstes Maß an Würdigkeit53 besitzt, kann offensichtlich niemals eine
wirkliche Pflicht sein. Und dass einer Handlungskategorie um überhaupt
keiner Sache willen der Status einer Pflicht zukommt, ist ebenso
undenkbar. Derweil ist aber denkbar und häufig der Fall, dass der
Wertträger, aufgrund dessen Würdigkeit eine Pflicht als Pflicht besteht,
etwas Anderes als eine Handlung ist. Vielmehr kann er auch ein Zustand,
ein Ding, eine Eigenschaft, ein abstraktes Konzept oder ein Lebewesen
sein. So ist beispielsweise unbezweifelbar, dass etwas objektiv Höherwertiges
Minderwertigem vorzuziehen obligat ist. Als Begründung hierfür lässt
sich allerdings |Obligates ist obligat|
nicht nachvollziehbar
anführen, wohl aber: „… weil Höherwertiges höheren Wert hat“, d.h.
Höherwertiges vorzuziehen ist obligat, weil dies a priori aus dem
Begriff des objektiven Wertes folgt. Damit ist der Begriff des
Obligaten, und somit auch der des Verwerflichen, von dem des objektiven
Wertes abhängig, beide enthalten ihn auf irgendeine Weise als
Komponente,54 und sein Begriff ist der tiefer und ihnen zugrunde liegende
Urteilsbegriff der Ethik.
Dementsprechend lässt sich |Obligates ist obligat|
mit einem Würdigkeitszukommnis begründen, während das Umgekehrte nicht
möglich ist: Warum ist Obligates obligat? Weil das Obligate Würdigem
gerecht wird und dies obligat ist. Weswegen ist Würdigem gerecht zu
werden obligat? Eben wegen der Würdigkeit von Würdigem, d.h. weil
Würdiges würdig ist. Derweil ist es unmöglich, das letztere damit zu
begründen, dass Obligates obligat sei, oder mit einem sonstigen
Obliganz- oder Verwerflichkeitsurteil. Daraus folgt etwas, das sich
zusätzlich dadurch bestätigt, dass wenn in Begründungsketten wie in den
Beispielen aus 2.3.5 die Begriffe des Würdigen und Unwürdigen anstelle
der Begriffe des Obligaten und Verwerflichen eingesetzt werden, sich
dann feststellen lässt, dass die Kohärenz der Ketten tatsächlich voll
erhalten bleibt. Nämlich: Obliganz- und Verwerflichkeitsurteilen liegen
grundsätzlich Würdigkeitsurteile zugrunde, welche damit die
eigentlichen Sätze der Ethik sind. Die fundamentalen Urteilsadjektive
der Ethik sind in letzter Konsequenz also:
- würdig
- unwürdig
- indifferent
Mit dem Begriff der Würdigkeit liegt nun endlich ein Urteilsbegriff vor, der sowohl elementar55
ist, als auch offensichtlich einen Bezugsraum besitzt, der weit über
denjenigen der Begriffe der Obliganz und der Verwerflichkeit hinausgeht,
ja sogar völlig uneingeschränkt ist, wodurch er auch auf Entitäten und
sonstige Non-Aktionalitäten beziehbar ist. Zudem gehört es zur Essenz
des Begriffs (der sich übrigens auch unabhängig von seiner Vokabel
erfassen lässt56) absolut frei von subjektiven Bestimmungen
zu sein, sowie den absoluten Horizont der menschlichen Erkenntnis zu
bilden, so dass es unmöglich ist, jemals hinter ihn zu treten: Egal um
welche Angelegenheit es sich handelt und auf welcher sonstigen Basis man
argumentiert (z.B. auf einer logischen oder empirischen), lässt sich
jedem auf einer solchen anderen Basis erzielten Ergebnis mit der Frage
nach der Würdigkeit der Anspruch auf Endgültigkeit entziehen („Ja, aber
ist es denn würdig, es so zu halten?“ bzw. „Was rechtfertigt das?“).57 Daher erweist er sich als der zentrale und entscheidende Begriff des ethischen Urteilsvermögens.
Fest steht damit und angesichts der sonstigen Ausführungen auch der apriorische Ursatz der Ethik, welcher ein Würdigkeitsurteil sein muss, und dem der gesamte normative Geist entspringt:
|Würdiges ist würdig|
Der Satz reflektiert eine Würdigkeitsbeimessung a priori, welche die Kategorie des Würdigen zum Gegenstand hat.58 Aus demselben Grund wie schon bei den apriorischen Obliganz- und Verwerflichkeitsurteilen (s.o.) ist kein anderes intrinsisch evidentes und voraussetzungslos apriorisches Würdigkeitsurteil denkbar. Ebenso ist kein weiterer Satz als innerster
Kern der sittlichen Ratio denkbar, was aus der Elementarität und
Ultimativität des Würdigkeitsbegriffs folgt. Objektiv kann Ethik im
Übrigen nur sein, wenn sie theoretisch von jedem willensfähigen
Intellekt ungeachtet seiner Umstände und Vorerfahrungen erkannt werden
kann. Somit muss die ethische Basis ein kleinster gemeinsamer Nenner
aller existierenden und auch aller möglichen nicht-existierenden
Willensintellekte sein, an dem sich theoretisch alle Sätze mit dem
Anspruch ethischer Richtigkeit messen lassen. Eine Vielzahl von Sätzen
kann der Nukleus also nicht sein. Ja nicht einmal mehr als ein
singulärer Basissatz zu sein kommt für ihn in Frage (wie schon unsere
intuitive, oftmals lautstarke Verurteilung ethischen Messens mit
zweierlei Maß ahnen lässt). Denn selbst wenn es auch nur zwei Ursätze
gäbe, die sich nicht voneinander ableiten59 – zwischen ihnen
zu priorisieren oder auch nur ihre Gleichwertigkeit festzustellen fällt
ausschließlich in den Kompetenzbereich des ethischen Urteilsvermögens.
Hierzu allerdings bräuchte es einen dritten, noch tiefer liegenden Satz.
Leiten sich die beiden aber voneinander ab, ist in Wahrheit nur einer
der beiden der Basissatz. Haben sie eine gemeinsame Wurzel, ist keiner
der beiden der Basissatz. Also kann es in letzter Konsequenz nur einen
einzigen Prüfsatz der Ethik geben. Jedenfalls scheinen nicht einmal die
Sätze |Obligates ist obligat|
und |Verwerfliches ist verwerflich|
aus einander ableitbar zu sein,60 was von der Anforderung der Rückführung aller objektiven Ethik auf einen einzigen Ursatz abweichen würde.
2.3.7 Erschließung des Wertekosmos: Erster Weg
Um theoretisch zum Rest der Sätze zu gelangen, gibt es zwei denkbare Wege. Der eine verläuft sozusagen vom Phänomenalen zum Normativen: Nach der empirischen Feststellung, dass eine Wertbeimessung – und somit auch die im Ursatz einbezogene – zwangsläufig Folgehaltungen sowie andere als den ursprünglichen Gegenstand der Beimessung betreffende Folgewertbeimessungen nach sich zieht, wird auf der Basis der Selbst- und Menschenkenntnis zusammengetragen, welche bzw. welcher Art diese sind und die Frage beantwortet, was die allgemeine Regel ist, welche diesen Folgen zugrundeliegt und für jeden Gegenstand einer Wertbeimessung gilt. Dieser Weg macht sich die Tatsache zunutze, dass das Fehlen einer zwangsläufig zu erwartenden Wertschätzung auf das Fehlen oder zumindest einen Mangel der ihr zugrundeliegenden Wertschätzung hindeutet. Z.B. weist im Allgemeinen die völlige Gleichgültigkeit gegenüber den Mitteln zur Erhaltung eines als zur Flüchtigkeit tendierend bekannten Gegenstandes auf das Fehlen oder relative Niedrigkeit der Wertschätzung des Gegenstandes selbst hin. Wenn die im Ursatz enthaltene Wertbeimessung ethisch notwendig ist, ist auch die zwangsläufig an ihr hängende Kette von Folgewertbeimessungen und jedes einzelne ihrer Glieder vielleicht nicht an sich, aber insofern ethisch notwendig, als sie von etwas ethisch Notwendigem bedingt sind und als seine Stellvertreter fungieren. Das Ausbleiben einer solchen Folgewertbeimessung oder eine andere, die ihr widerspricht, widerspricht dem Ursatz auf diese Weise zwar nur indirekt, aber sie widerspricht ihm. Die Verurteilung einer unrechten Willentlichkeit (z.B. Diebstahl oder eine rassistische Gesinnung) gilt hier stets der ungenügenden Urwertbeimessung, die sie beweist. Jedes Würdigkeits- oder Unwürdigkeitsurteil in einem Folgesatz ist nicht viel mehr, aber auch nichts weniger als eine auf der Oberfläche seines Gegenstandes entstandene Reflexion des Urteils aus dem Ursatz.
Ein Einwand, demzufolge damit dann ja eine empirische Komponente in die allgemeine Ethiktheorie einträte, so dass den auf dieser Grundlage erschlossenen normativen Sätzen keine absolute Gewissheit und zudem durch die speziell an der Natur des Menschen orientierte Sondierung der Grundimplikationen61 einer Wertbeimessung keine absolute Allgemeingültigkeit zukäme, würde sich hiermit auf eine durchaus zu gestehende Tatsache berufen und dennoch weitestgehend irrelevant sein, denn:
- Die zu berücksichtigenden Dispositionen sind so trivial und typisch, dass der Grad ihrer Unsicherheit der unter ihrer Berücksichtigung ermittelten normativen Sätze verschwindend gering und vernachlässigbar ist.
- Die Unsicherheit beruht auf der geringen Wahrscheinlichkeit, dass einige Menschen dispositional doch anders strukturiert sind und nichts dafür können könnten. Schränkt man im Rahmen einer Definition den Kreis der Diskursteilnehmer explizit auf „normale“ Akteure ein, so dass die ausschließliche Geltung für sie stets mitgemeint ist, und schließt man Sonderfälle aus (was ohnehin eine Selbstverständlichkeit sein sollte), haben die normativen Sätze für den Kreis quasi-absolute Gewissheit.
- Für das die situationsrelevanten Dispositionen besitzende Individuum hat der jeweilige Satz praktisch absolute Gewissheit, spätestens sobald es seiner korrekt verlaufenden und wurzelnden Begründungskette gewahr wird.
- Wenn die normativen Sätze nur für den Menschen gelten, ist dies für Diskurszwecke i.d.R. ausreichend.
- Der Kreis der aktualen und potentiellen Vernunftwesen, für welche sie gültig sind, weitet sich aus, falls mit dem materiellen Kosmos interagierende und ihn wahrnehmende Vernunftwesen nur mit solchen Dispositionen denkbar sind.
Es existieren (zumindest auf dispositionaler Ebene) in jedem verantwortungsfähigen Menschen und ethikepistemologisch analog strukturierten Wesen bekannte bzw. unleugbare Haltungen, deren Zustandekommen oder Nicht-Zustandekommen notwendig auf das Vorliegen oder Fehlen einer (u.U. erforderlichen) Zuordnung von Würdigkeit hinzuweisen geeignet ist bzw. daraus resultiert, und deren spezifische Ausprägungen somit im Einklang oder Widerspruch zum Ursatz oder auf diese Weise abgeleitete Folgesätze stehen. Was davon auf das Vorliegen eindeutig hinzuweisen geeignet sein sollte, ist als würdig zu beurteilen, und was auf das Fehlen oder das Vorliegen bezüglich des Gegenteils hinzuweisen geeignet sein sollte, ist als unwürdig zu beurteilen. Die metaethische Aufgabe lautet, diese Implikationen in ihrer möglichst allgemeinen Form zusammenzutragen, die Regeln dafür zu finden, nach denen sie sich in ihren Ausprägungen manifestieren und diese Regeln anzuwenden.62
Dabei kristallisiert sich heraus, dass die zahlreichen Implikationen63 im Prinzip als Ausprägungen dreier fundamentaler Kategorien auffassbar sind:
- Vergegenwärtigungsbemühung
- Interaktionsanstrebung
- Entkoppelte (irreduzible) Konditionierungen
Die Art, wie sich diese bei der Wertschätzung des jeweiligen Gegenstandes äußern, wird wiederum von drei Faktoren beeinflusst:
- Natur des Gegenstands in der Auffassung des Akteurs
- conditio personalis
- Relative Position des Gegenstands in der individuellen Wertehierarchie des Subjekts
Um sich für die Aufstellung deskriptiv-normativer Sätze mit möglichst hoher Allgemeingültigkeit zu qualifizieren, stellt sich dieses Faktorentriplett wie folgt dar:
- Natur des Gegenstands, wie sie wirklich oder quasi64 wirklich ist.
- conditio humana
- Relative Position des Gegenstands in einer universalen Wertehierarchie
2.3.8 Erschließung des Wertekosmos: Zweiter Weg
Der zweite Weg verläuft sozusagen umgekehrt, d.h. eher vom Normativen zum Phänomenalen: Gemäß unserer apriorischen Kenntnis des Würdigkeitsbegriffs ist mit Würdigkeit offensichtlich und untrennbar verbunden, dass ein Gegenstand, dem sie zukommt, Bezugnahme auf ihn (im Sinne der Einnahme einer Haltung um seinetwillen) verdient. Die Würdigkeit der wie auch immer gearteten Bezugnahme auf das Würdige ist die für den Begriff der Würdigkeit spezifischste und ihm am engsten anhaftende, wenn nicht in letzter Konsequenz gar einzige, jedenfalls (und sei es unergründlicherweise) unleugbare Implikation. Soweit weder eine Spezifikation für das Subjekt noch eine für das Objekt (auch keine umstandsbedingte) vorliegt und lediglich seine Würdigkeit feststeht, liegt auch kein Grund vor, die erforderliche Bezugnahme in irgendeiner Weise einzugrenzen oder zu spezifizieren. Daraus folgt, dass dem Gegenstand im allgemeinsten Fall zunächst keine dem Subjekt mögliche Art von Bezugnahme vorenthalten zu werden sich geziemt, sondern jede denkbare und mögliche erforderlich ist, sei sie innerlich oder äußerlich, auf Aktivität oder auf Passivität basierend, direkt oder indirekt, allerdings abzüglich jener speziellen Formen von Bezugnahme, durch welche (z.B. aufgrund ihrer Natur) die Möglichkeit der generellen Bezugnahme auf den Gegenstand gefährdet oder beeinträchtigt wird.
In dieser Subtraktion besteht eine der ersten zu erwartenden Eingrenzungen und Spezifizierungen der Bezugnahme. Sie ist notwendig, da solche Bezugnahmen zur Würdigkeit der allgemeinen Bezugnahme auf das Würdige im Widerspruch stehen. Sie sind wertwidrige Bezugnahmen zu nennen. Hingegen besitzen alle Maßnahmen, welche allgemein die Möglichkeit der Bezugnahme auf einen würdigen Gegenstand herstellen, fördern oder erhalten, zweifellos Würdigkeit. Die weitere Eingrenzung und Spezifizierung der Bezugnahme beruht auf der Natur des Objekts, die ontologisch bedingt meist nur einen Ausschnitt aller nach Abzug der wertwidrigen Bezugnahmen verbleibenden Haltungen zulässt, zumal z.B. nicht jedes Objekt berührbar ist, nicht jedes visuell wahrnehmbar, nicht jedes lesbar, nicht jedes physisch nahbar etc..
2.3.6 Verweis zur Vertiefung
Keine der Komponenten des Urteilsvermögens ist so tief in die menschliche Intuition eingebettet wie die ethische. Und dennoch - oder gerade deswegen und sicherlich aus vielen weiteren Gründen - gestaltet es sich bei keiner anderen Vernunftkomponente so diffizil, den Grundriss ihrer Idealform analytisch nachzuzeichnen. Darum musste die Darstellung einiger Zusammenhänge in diesem Kapitel einigermaßen verkürzt geraten und konnte nur mehr oder weniger die Quintessenz des kontemplativen Repositoriums „Um das wahrhaft Würdige“ sein, das sich zur Heranziehung für ausführlichere Darlegungen und Beseitigungen potentieller Einwände eignet.
3. Koordination
Wenn das Erkenntnisvermögen aus drei Komponenten zusammengesetzt ist, stellt sich natürlich die Frage, in welchen Fällen jeweils und in welcher Kombination diese eingesetzt zu werden haben, ob diese auch mal in Konflikt miteinander geraten können, und wenn ja, wie zwischen ihnen zu priorisieren ist. Lohnend ist daher für diesen Zweck, zunächst mit einer komparativen Gegenüberstellung zu beginnen.
3.1 Komparative Betrachtung der Triade
Eine gegenüberstellende Betrachtung der drei Komponenten des Erkenntnisvermögens liefert sowohl eine besondere intellektuelle Faszination als auch möglicherweise einen Schlüssel zu weiteren Erkenntnissen über das rationale Urteilsvermögen selbst. Während durch eine solche Gegenüberstellung ins Auge springt, in welch antipodischem Verhältnis Logik und Empirik zueinander stehen, bringt ein sich anschließender Blick des Vergleichs auf die Ethik den Eindruck mit sich, dass diese „dritte“ Komponente des Intellekts die Eigenschaften von Logik und Empirik in Form einer Synthese oder Vermittlungsposition in sich vereinen möchte. In besonders ästhetischer Weise bietet sich dieser Eindruck, wenn man bedenkt, dass eine logische, eine empirik- und eine ethikbasierte Untersuchung prinzipiell jeweils der untersuchende Vergleich eines Satzes ist mit
- (exakt) einem Satz, der jener selbst ist.
- (bis zu) allen Sätzen, die nicht jener selbst sind.
- (exakt) einem Satz, der nicht jener selbst ist.
Der Eindruck der Synthese bzw. der Vermittlungsposition kommt desweiteren darin auf, dass Ethik einerseits einen logischen Charakter zu besitzen scheint, weil neben der Einheit des Prüfmittels ihr Prüfstein in letzter Konsequenz apriorisch und somit statisch ist (auch wenn in der abstraktiven Dialektik der ethischen Art vordergründig auf formalethische Grundsätze und weitere Sätze zurückgegriffen wird; diese sind allerdings teils von vollständiger, teils von weitgehender Statik), und darin, dass die Methode der Deduktion in der Ethik ähnlich wie in der Logik eine große Rolle spielt. Andererseits hat sie derweil mit der Empirik gemeinsam, dass auch ihre Urteilsbegriffe einen graduellen Charakter besitzen, dass das zu Untersuchende bei ihr ebenfalls nicht sein eigenes Prüfmittel ist, und dass in der Ethik wie in der Empirik auf einen Pool an Sätzen zurückgegriffen wird, der sich als hierarchische Schichtenarchitektur denken lässt. Dies wären drei Gemeinsamkeiten mit der Logik, und drei Gemeinsamkeiten mit der Empirik.
Zugleich scheint sie zu der Erhabenheit eines Sonderwegs bzw. eines gewissen Neutralismus zu tendieren, indem sie dort, wo eine Gemeinsamkeit zwischen Logik und Empirik besteht, ausschert und von beiden - in ebenfalls drei Dingen - abweicht: Während Logik und Empirik beide hauptsächlich epistemische Korrelate (bzw. den jeweils enthaltenen Truncus) untersuchen und um die Einordnung solcher bestrebt sind, geht es der Ethik um die Einordnung von Begriffen allgemein, auch solchen, die keine Korrelate darstellen oder einen korrelattypischen Truncus enthalten. Und während das Ziel logischer und empirischer Untersuchungen die Produktion oder Bestätigung faktualer Korrelate ist, geht es der Ethik um die Etablierung wertender Korrelate. Der dritte Aspekt des Sonderwegs der Ethik ist der vielleicht erstaunlichste und betrifft das Thema der Fundamentalsätze.
Die Fundamentalsätze von Logik und Empirik sind einander zunächst scheinbar nicht so gleich, dass man eine Eigentümlichkeit der Ethik in diesem Punkt einen Sonderweg zu bezeichnen geneigt ist: In der Logik ist das Fundamentale, dass Affirmatives und Negationales niemals gleichgesetzt werden darf, und in der Empirik zunächst die apriorische Direktive der primitivsten denkbaren Verallgemeinerungsregel, die freilich im Zuge der Reifung des Intellekts durch immer leistungsfähigere Verfeinerungen ersetzt wird, die letztlich aber allesamt in ihr ihren Anfang haben. So weit, so unterschiedlich. Die ausschlaggebende Gemeinsamkeit ist aber: Weder ist der Fundamentalsatz der Logik ein logisches Urteil oder lässt sich mit Logik begründen, noch ist derjenige der Empirik ein empirisches Urteil oder lässt sich mit empirikbasierten Mitteln begründen. Wie denn auch, die Begründung wäre ja zirkulär oder bräuchte selbst eine Begründung(skette) ad infinitum, und eine gegenseitige Begründung der beiden Intellektkomponenten würde ebenfalls eine Zirkularität konstituieren. Die Grundlage der Logik steht also außerhalb der Logik, die der Empirik außerhalb der Empirik. Dennoch lässt sich für Zwecke der Logik kein fundamentalerer als ihr Fundamentalsatz, und für Zwecke der Empirik kein fundamentalerer als ihr Fundamentalsatz denken.
Was ist nun der Fundamentalsatz der Ethik? Sehr fundamental wäre einfach die Regel, dass nichts dem ethischen Ursatz widersprechen oder von ihm signifikant abweichen dürfe. Diese Regel gehört zwar tatsächlich und offensichtlich untrennbar zur Ethik und ist sehr fundamental, besitzt für ihre Zwecke jedoch noch nicht die äußerste denkbare Fundamentalität, denn es lässt sich immer noch fragen, warum nichts ihm widersprechen oder von ihm abweichen dürfe, zumal Widersprüche und Abweichungen nichts an sich Böses sind. Mehr noch - die Frage lässt sich nicht nur stellen, sondern auch einsehbar beantworten, und zwar mit der Begründung: Eben weil Würdiges würdig ist. Die besondere Natur des Begriffs des Würdigen ermöglicht der Ethik somit etwas, was für Logik und Empirik undenkbar wäre: Ethik lässt sich mit einem Mittel ihrer selbst begründen. Und ihr Ursatz ist nicht nur ein Ursatz, ein ethisches Urteil und ein Prüfstein, sondern zugleich auch der denkmethodische Fundamentalsatz der Ethik.
*) Jedes Sternchen in der Tabelle soll eine leichte Einschränkung bzw. einen leichten Ergänzungsbedarf andeuten, siehe Fußnote.65
.
3.2 Hierarchie und Priorisierung
3.2.1 Logik vs. Empirik
Die Denkbarkeit vorausgesetzt, dass (korrekt angewendete) Logik und Empirik zu einander widersprechenden Ergebnissen führen, ist zunächst einmal die höhere, da nach konspektiven Maßstäben vollkommene Beweiskraft der Logik zu würdigen und insofern im Konfliktfall der Logik gegenüber der Empirik der Vorzug zu geben und das Ergebnis der letzteren zu verwerfen. Dies ist grundsätzlich festzuhalten, bevor wir im Zuge einer Differenzierung zu einer Relativierung dieses Grundsatzes übergehen. Der Grund für diesen Primatus der Logik gegenüber der Empirik ist offensichtlich: Logische Deduktionen sind vollkommen zwingend, während Empirik auf Induktion beruht, deren Urteile gerade für den ausgereiften Intellekt ohne Weiteres nie die Hundertprozentmarke der Wahrscheinlichkeit wirklich erreichen - rein empirische Urteile sind technisch betrachtet stets nur vorläufig, und alle genuine Empirik spielt sich ausschließlich im Bereich der logischen Kontingenz ab. Daran ändert auch nichts, dass viele empirische Urteile auf so häufigen ausnahmslosen Bestätigungen beruhen und dadurch der Hundertprozentmarke so nahe kommen, dass typischerweise psychologische Gewissheit mit ihnen einhergeht. Signifikant für den Vorrang der Logik ist, dass während bloß empirisch Unmögliches immer denkbar und oft sogar sinnlich vorstellbar ist, logisch Unmögliches weder denk- noch vorstellbar ist, sondern höchstens sprachlich (d.h. syntaktisch und grammatisch richtig) formulierbar. So ist die erfolgreiche Stapelung mehrerer Nadeln übereinander auf ihren Spitzen ohne stabilisierende Hilfsmittel ab einer gewissen Zeitspanne und Anzahl von Nadeln empirisch (relativ) unmöglich (d.h. ungeheuer unwahrscheinlich), doch es ist je nach Vorstellungsvermögen ein Leichtes, sich die unwahrscheinliche Situation bildlich vorzustellen. Dass das Doppelte einer Ganzzahl ungerade ist, oder dass etwas aus Teilen Zusammengesetztes zugleich eine vollkommene Einheit (S) in jeder Hinsicht ist, ist hingegen weder denk- noch vorstellbar.
Als Laien genügt uns zur Anerkennung eines bisher unbekannten Verwandtschaftsverhältnisses das Zeugnis eines langjährigen Labors für DNA-Analysen mit bester Reputation. Ein Richter, der auf dieser Basis ein Urteil fällt, tut dies unter Anwendung seines empirischen Urteilsvermögens, im Hinblick auf die hinreichend einwandfreien Erfahrungen mit dem Labor, seinen Wissenschaftlern und seinen Methoden. Sollte eines Tages das Zeugnis desselben Labors lauten, jemand habe seinen eigenen Großvater gezeugt, würde der Richter alle Expertise und Reputation des Labors ignorieren und die Faktualisierung der Behauptung unterlassen - die Logik verhindert es.
Logik ist sogar eine Voraussetzung für Empirik, d.h. ohne jene könnte diese nicht funktionieren. Schon die Feststellung der Abweichung eines Erlebnissatzes von anderen (oder seiner Harmonie mit ihnen) ist eine logische. Derweil ist das Umgekehrte nicht der Fall, d.h. Empirik ist keine Voraussetzung für Logik (was nicht damit zu verwechseln ist, dass sinnliche Wahrnehmung als „Materiallieferant“ eine wichtige Rolle spielt).
Der Primatus der Logik über die Empirik wird von der letzteren selbst bestätigt, zumal sich jede logische Deduktion in eine empirische Induktion konvertieren lässt, nicht aber jede Induktion in eine Deduktion. Dies folgt daraus, dass sich im Zuge rationaler Betrachtungen die Unmöglichkeit des Zutreffens eines widersprüchlichen Satzes bzw. ein logisch notwendig zutreffender Satz zu den Sätzen des Pools hinzugesellt, auf den die Empirik zurückgreift. Aus der Sicht der Empirik sind logische Urteile notwendigerweise stets „korrekt“, während hingegen aus der Sicht der Logik ein genuin empirisches Urteil über die Notwendigkeit oder Unmöglichkeit eines Sachverhalts ohne Einschränkung nie zustimmungsfähig ist.
Daraus folgt: Widerspricht Empirik sich selbst, d.h. ein empirisches Notwendigkeitsurteil einem anderen, ist das Urteil mit dem höheren Sicherheitsgrad in jedem Fall vorläufig vorzuziehen; widersprechen sich aber Logik und Empirik, ist das Urteil der Logik, solange es kein bloßes Kontingenzurteil ist, in jedem Fall vorzuziehen.
3.2.2 Die wahre Hauptkomponente der Vernunft
Das bedeutet allerdings weder, dass sich Logik aus sich selbst rechtfertigen lasse, noch dass Logik als Vorsteherin des Urteilsvermögens ausreiche und nicht selbst einer Urteilsinstanz, die nicht mit ihr identisch ist, unterstehe. Beschränkt man sich im Denken ausschließlich auf Logik und Empirik, gibt es nämlich z.B. das unauflösbare Problem, dass der Sprung vom Empirikurteil zur Etablierung eines Faktualkorrelats nie objektiv gerechtfertigt wäre. Es gäbe dann nämlich kein objektives Kriterium, ab welchem Sicherheitsgrad eine solche Etablierung erfolgen sollte, weder für z.B. ab 77,8 %, noch für ab 88 %, noch ab 95 %, folglich auch nicht für ab 99 %, 99,9 %, oder noch mehr; und genuine Erfahrungsurteile erreichen ja nie volle 100 %. Die Logik hilft derweil hier nicht weiter, denn nach ihren Kriterien sind alle Urteile der Empirik gleich kontingent. Für mit logischer vergleichbarer empirischer Sicherheit müsste für einen Sachverhalt eine unendliche Menge ausnahmsloser Bestätigungen vorliegen. Rechnerisch sind die Sachverhalte der Empirie, gleich wie wahrscheinlich sie sein mögen, allesamt gleichermaßen, da unendlich weit davon entfernt.
Das Kriterium danach zu bestimmen, was sich als am nützlichsten o.ä. bewährt hat, ist ohne Weiteres nicht nur jedem Objektivitätsanspruch widersprechende Willkür, sondern führt auch in den infiniten Regress (die Möglichkeit der - immerhin nur empirikbasiert möglichen - Feststellung als nützlich bedarf selbst des Kriteriums). Und sowohl der Verweis auf natur- und genetisch bedingte, anthropologische Voreinstellungen hinsichtlich des gesuchten Kriteriums als auch jede Beschreibung der rein logischen und empirischen Methoden wäre bzw. ist höchstens eine Erläuterung der tatsächlichen Funktionsweise des menschlichen Verstandes. Bloß zu erläutern, wie der Intellekt zum Zwecke der Erlangung von Erkenntnis zufälliger- bzw. natürlicherweise funktioniert, bedeutet jedoch längst nicht, gezeigt zu haben, dass er zu diesem Zwecke so funktionieren sollte. Es wäre damit allein noch nicht gezeigt, dass die seinigen auch die objektiv erforderlichen und zuverlässig(st)en Methoden sind, um zu objektiver Wahrheit bzw. objektiv und wahrhaft gültigen Urteilen zu gelangen. Bloß - wenn überhaupt - das reale, nicht aber das ideale Urteilsvermögen wäre beschrieben. Die optimale Tauglichkeit des realen konspektiven Urteilsvermögens, ob vor oder nach einer eventuellen Optimierung, kann durch es selbst nicht bewiesen werden, ohne einem Zirkelschluss aufzusitzen. Zum Zwecke der Erlangung objektiver Erkenntnis lassen sich Logik und
Empirik nicht mit Logik und Empirik verteidigen oder rechtfertigen. Dies bedeutet nicht, dass sie sich überhaupt nicht rechtfertigen lassen, nur eben können Logik und Empirik selbst dies nicht leisten.
Das konspektive Urteilsvermögen (Logik und Empirik) ist folglich nicht das Oberhaupt des objektiven Intellekts, und auch keine ihrer Komponenten kann dies für sich in Anspruch nehmen. Vielmehr muss die einzige von den Komponenten des gesamten menschlichen Urteilsvermögens, die verbleibt, um für den Status des Oberhaupts in Frage zu kommen, ihre non-konspektive (d.h. non-faktizistische) Komponente sein, nämlich die Ethik, welche das praktische bzw. wertende Urteilsvermögen ist. Sie ist es, welche die gesuchte Leistung zu erbringen geeignet sein muss, wenn auch nur die Chance bestehen soll, dass es objektive, wahrhafte konspektive Beweise für irgendetwas geben kann. Ansonsten kann es weder authentisches Wissen noch Erkenntnis des Menschen geben. Derweil ist ihrem Ursatz, der als einziger Satz der menschlichen Erkenntnis keiner weiteren Begründung bedarf und hierdurch dem Zirkelschluss zu entgehen ermöglicht, anzusehen, dass sie dafür geeignet ist.
Allein schon die Tatsache, dass der Fundamentalsatz der Ethik in jenem Ursatz besteht und somit ein Teil der Ethik selbst ist, während die Fundamentalsätze der beiden anderen Komponenten jeweils aus keinem von ihnen ableitbar sind, eignet sich als Anlass zu dem Verdacht, dass Logik und Empirik ihre Gültigkeit aus der Ethik beziehen (müssen). Dieser Verdacht erhärtet sich bei einer näheren Betrachtung der Fundamentalsätze von Logik und Empirik und der Feststellung, dass es sich bei ihnen um Regeln und somit um normative Sätze handelt bzw. solchen direkt entwachsen. Wie trefflich - wenn auch zugegebenermaßen analytisch nicht besonders relevant - scheint es in diesem Lichte, dass die sittliche Ratio kraft ihrer Merkmale im Verhältnis zu denjenigen der Logik und Empirik an eine Art Synthese derselben erinnerte, als sei sie die Mutter zweier Sprösslinge, von denen jeder seine genetische Herkunft von ihr dadurch nahezulegen vermag, dass er einen Teil ihrer Merkmale geerbt zu haben scheint...
So sehr Logik dafür bekannt ist, dass ihre Schlüsse „zwingend“ sind, so wenig darf dies darüber hinwegtäuschen, dass diese anzuerkennen ein freier, ethischer Akt ist - oder wenigstens in einem solchen wurzelt. Denn sie wirken auf das denkende oder debattierende Individuum nur dann zwingend, wenn dieses ernsthaft konsequent und konsistent sein will. Ansonsten lernen wir aus der Erfahrung, dass manchen Menschen die logische Widersprüchlichkeit ihres Glaubensgebäudes tatsächlich erstaunlich egal ist, wenn man sie auf diese aufmerksam macht, und manche dies sogar zu einem Vorzug ihrer Glaubenshaltung erheben. Das Zwingendsein der Logik ist folglich für sich allein genommen nicht nur ungeeignet, um als Beweis der Wahrheit ihrer Sätze herzuhalten (wie kann etwas allein deswegen wahr sein, weil man gezwungen ist, es als wahr anzuerkennen?), ihr Zwingendsein ist darüber hinaus an einen Willensentschluss geknüpft.
3.2.3 Sicherstellung des Primats der Ethik
Zur Bezweifelung des Primats der Ethik gegenüber den beiden anderen Komponenten des menschlichen Urteilsvermögens könnte eingewendet werden, wie denn die Ethik der Logik und Empirik Vorschriften machen könne, wenn sie dies allein anhand von (normativen) Sätzen machen könne, die sie ohne die Anwendung logischer Regeln und empirische Gegebenheiten so nicht gebildet hätte, zumal die typischen Implikationen von Wertbeimessung nur empirisch feststellbar seien. Eine sicherlich berechtigte, aber nicht hinreichende Entgegnung hierauf wäre, dass zwar die empirische Realität (S) der conditio humana und der Natur der Gegenstände Faktoren in der Ausbildung des idealen normativen Geistes seien, dies jedoch ausschließlich ausgehend von einem transzendentalen Faktum, d.h. nur unter der Bedingung der ausschlaggebenden optimalen Ausrichtung des Subjekts auf das Würdige, welche sich jeder empirischen Erklärung entziehe. Vielmehr wäre der Hinweis erforderlich, dass der Einwand das Resultat einer Verwechselung zwischen Ethik und Metaethik (bzw. Ethiktheorie) sei. Ethik (über das reine Urteilsvermögen hinaus) ist die Gesamthaltung des optimal auf das Würdige ausgerichteten, intellektbegabten Subjekts, und ein solches Subjekt (metonymisch „Intellekt“) trifft seine Entscheidungen eben nicht auf der Grundlage jener Grundimplikationen als denkerische/reflektorische Gründe, d.h. im vortheoretischen Grundmodus sagt sich der Intellekt im rein ethischen Kontext nicht (und darf es nicht): „Weil meine Natur und die Natur des Gegenstandes A gemäß meiner Erfahrung die Folgewertbeimessung X evozieren, werde/muss ich Gegenstand B wertschätzen“ oder „... ist es obligat, Handlung Y tun“, sondern für den Intellekt spiegelt sich die Würdigkeit der einen Wertträger in den anderen abgesehen von ihrer begrifflichen Verknüpftheit untereinander unergründlicherweise und ohne den kleinsten Raum für eine naturkausale Begründung, sowie i.d.R. ohne dass ihm vortheoretisch irgendwelche als involviert auftretenden naturalen Faktoren sichtbar wären, geschweige denn, dass er auf solche rekurriert. Erst die eigentlich dem konspektiven Arbeitsfeld angehörige, zumal in einem notwendigerweise deskriptiven Modus operierende Ethiktheorie forscht nach solchen Faktoren aus einer ganz anderen Perspektive (für deren gerne schnell angenommene Überlegenheit es ohne Zirkelschluss keinen Beweis geben kann) und ermittelt sie, da sie einen anderen Zweck als der rein ethische Intellekt im vortheoretischen Modus verfolgt, nämlich zu antizipieren, wie sich der normative Geist des durchschnittlichen wohlausgerichteten Individuums gestaltet, um eine Universalisierung vornehmen zu können, deren Resultat für den intersubjektiven ethischen Diskurs geeignet ist und eine extrem und hinreichend, jedoch niemals absolut sichere Aussage darüber treffen kann, ob ein bestimmtes Individuum mit einer bestimmten Handlung dem Würdigen gerecht wird oder sich gegen es vergeht.66 Derweil erkennt das ethische Urteilsvermögen die Erklärungen der Ethiktheorie ungeachtet ihrer Einräumung eines transzendentalen Hintergrundes - für manchen verblüffend: - nicht an.
Zwar mag man meinen, dass es doch im Interesse der Ethik liegen müsste, ihre Inferenzmuster als potentiell aus einem naturalen „Mechanismus“ hervorgehend infrage zu stellen und, um die Reinheit der Intellektualität und Ethizität ihrer Inferenzen und Resultate sowie die Freiheit derselben von Kontingenz sicherzustellen, Anlass zu einer solchen Infragestellung zu geben (d.h. dass es einen entsprechenden, gültigen normativen Satz geben müsste); durch die urethische Veranlassung einer solchen Operation besäße diese und ihre Resultate immerhin eine gewisse intellektuale Legitimation. Doch sowohl die Grundlage der Infragestellung (der ethische Wert) als auch die Gültigkeit und Relevanz ihrer Resultate wären dadurch selbst der Infragestellung und ihrer Konsequenzen ausgesetzt - die Infragestellung wäre zwangsläufig zugleich eine Infragestellung ihrer selbst - , womit die Operation sinnlos wäre. - (Darüber hinaus wäre ein Wissen um solche Mechanismen für die Gültigkeit der Ethik wohl von ähnlich geringem Wert wie das Wissen um Schallwellen, Hirnphysiologie und Sprachentwicklung für das Verständnis der Bedeutung gesprochener Worte.)
Dies bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass wir die von der Ethiktheorie zusammengetragenen Gesetzmäßigkeiten der Wertbeimessung nicht als Faktum ansehen dürfen. Denn bei der Verweigerung der Anerkennung handelt es sich nur um die der absoluten und bedingungslosen, nicht aber jeder Art von Anerkennung; ausgeschlossen wird lediglich eine Relevanz eines solchen Faktums für die Gültigkeit der Ethik und ihren Rang als Oberhaupt des Intellekts sowie jeglicher Relativierungseffekt in Bezug auf sie.67 Dies würde selbst dann gelten, wenn es einen Widerspruch implizierte, denn der wäre aufgrund der Zugehörigkeit seiner Art zum Feld des Konspektiven hier ebenfalls irrelevant. Hierdurch ist es beispielsweise möglich, die Stärke der Ethiktheorie gegenüber konkurrierenden Entwürfen zu würdigen.
Nachvollziehbar wäre nun die Sorge, dass die Ethik der Empirik Vorschriften mache, während sie doch irgendwie im Verborgenen von empirisch-naturalen Einflüssen, ja von zweifellos kontingenten Gegebenheiten bestimmt sei, so dass die Empirik infolge einer ihr aufgesetzten, durch diese kontingenten Gegebenheiten verzerrten Brille gefährdet sei, extrem falsche Resultate zu produzieren. Nachvollziehbarkeit, die immerhin auch auf der Universalität eines bloßen, psychologisch bedingten Reflexes beruhen kann, ist jedoch nicht dasselbe wie objektive Berechtigtheit. Erstens nämlich kommt die Definitionshoheit darüber, was richtige und was falsche Resultate sind, unter den Komponenten des Intellekts nur ihrem Oberhaupt zu, und wie gesehen können weder Logik noch Empirik einen solchen Rang für sich in Anspruch nehmen. Und zweitens greift die Ethik in das Geschäft von Logik und Empirik weniger tief ein, als dass die Sorge auch über einen ersten Anflug hinaus nachvollziehbar bleiben könnte. Denn weil Logik und Empirik unabdingbare und zentrale Instrumente in den Grundimplikationen von Wertbeimessung (insb. Vergegenwärtigungs- und Wahrnehmungsbestrebung) sind und jener beider Grundprinzipien (und sei es im Sinne einer nachträglichen Übernahme) von ihr selbst aufgestellte Prinzipien sind, hat Ethik auch ein dezidiertes Interesse68 daran, dass diese eingehalten werden, so dass sie nur von ihnen abweichen würde, wenn es überhaupt nicht anders geht und keinerlei Harmonisierung zwischen genuiner Ethik und konspektivem Intellekt erzielt werden kann. So können auch solche Faktualisierungen zugelassen werden, die in der Rolle der Erzeugung von Indizien ethikwidrige oder gar die gesamte Ethik relativierende und infrage stellende Folgefaktualisierungen nach sich zögen; lediglich der Beweisstatus hierfür würde ihnen vorenthalten und das Zustandekommen der ethikwidrigen Folgekorrelate verhindert. (Mit der Logik gäbe es - wenn überhaupt - noch weniger Probleme.) So beschränken sich die Eingriffe der Ethik, abgesehen von ihrer Forderung, dass jede Setzung, jede Unterlassung der Setzung und jede Verschiebung einer induktiven Untergrenze ohne ethische Rechtfertigung zu unterbleiben hat, auf Fälle unauflösbarer Konflikte im konspektiven Verstand (z.B. echte Antinomien): Für solche Fälle wird der Logik gegenüber der Empirik der Vorzug gegeben, sodann dem der Ethik Entgegenkommenderen gegenüber dem der Ethik weniger Entgegenkommenden.
Scheinbaren Unvereinbarkeiten kann die Ethik ansonsten mit einer Differenzierung des Wahrheitsbegriffs begegnen, so dass es solches geben mag, das uneingeschränkt als wahr zu bezeichnen ist, während anderes nur im Vergleich zu sonstigen Vertretern seiner Kategorie, solange nichts denkbar ist, das die Wahrheitsbedingungen ebenso gut erfüllen könnte, wahr ist, und wiederum anderes nur im Kontext eines bestimmten Zwecks.
3.2.4 Die Induktionsschwelle als ethische Bestimmung
Das erwähnte Konzept der Vorenthaltung des Beweisstatus eröffnet zugleich eine Perspektive zur objektiven Bestimmung einer allgemeinen induktiven Untergrenze: Diese läge demnach mindestens direkt oberhalb des Wahrscheinlichkeitsgrades der wahrscheinlichsten ethikwidrigen Implikation,69 die irgendein empirisches Faktum besitzt (oder besitzen kann). Ethikwidrige Resultate des Intellekts sind dadurch von vorneherein ausgeschlossen, aber der Logik und der Empirik sollte dieser Anschein von Tyrannei gleichgültig sein, da es ihre sonstigen Fakten sind, die ihr Material zum epistemischen Fortschritt und die weit überwiegende Mehrheit bilden, diese allesamt „unbehelligt“ bleiben und zu Erkenntnissen über Ethik zu führen ohnehin nicht zu ihrem primären Aufgabenfeld gehört. Zudem ist der Ausschluss nicht mehr als Tyrannei zu werten als seine Alternative, der Ausschluss unlogischer oder unempirischer Resultate. Jedenfalls wäre eine solche ethikwidrige Implikation nie etwas anderes als eine Interpretation und als solche immer von geringerer Wahrscheinlichkeit als jegliches Faktum, das zu ihrem Anlass bzw. zu ihrer Begründung dienen mag. So mögen beispielsweise das Libet-Experiment und seine späteren Ableger, die vermeintlich die Nicht-Existenz von Willen(sfreiheit) und somit die Unmöglichkeit von Verdienst und Schuld, ja sogar die Sinnlosigkeit aller Rede von Ethik nahelegen, allesamt so stattgefunden haben und alle Messungen korrekt gewesen sein (oder auch nicht). Diese aber so zu interpretieren, ist die Behauptung einer ethikwidrigen Implikation, die als umso wahrscheinlicher daherkommen mag, je sicherer die Richtigkeit der Messungen ist, jedoch nie denselben Wahrscheinlichkeitsgrad wie die Messungen selbst erreichen kann - ganz zu schweigen davon, dass plausible alternative Interpretationen und Gegeninterpretationen ihren Wahrscheinlichkeitsgrad weiter senken können.
Mit der obigen Definition liegt aber noch keine hinreichende Bestimmung der induktiven Qualifikatorschwelle vor, denn als alleiniges Kriterium ist sie zirkulär. Erst recht nicht sind wir anhand ihrer in der Lage, einen konkreten Prozent- oder Koinzidenzmengenwert für eine in allen Zusammenhängen gültige induktive Qualifikatorschwelle zu nennen. Ohnehin variiert diese notwendigerweise abhängig vom Kontext; dies freilich nicht auf Basis von Willkür, sondern nach einer rationalen Regel, die sich in den folgenden Beispielen abzeichnet: Wer mit dem Auto zu einem freizeitlichen Zweck in die Nachbarstadt fahren möchte, hat meist schon Planungen für seine dortigen Aktivitäten und sogar für Aktivitäten nach seiner Rückkehr etc., was bedeutet, dass er seine unversehrte Ankunft in jener Nachbarstadt für ein Faktum hält (oder eine dazu äquivalente Haltung hegt). Dies erscheint zumindest in Bezug auf grundsätzlich vorsichtige Fahrer legitim, angesichts von jährlich maximal ca. 3000 Verkehrstoten, die in Deutschland auf über zehn Milliarden Autofahrten kommen, also geschätzt drei auf zehn Millionen. Dies gilt erst recht insofern, als eine davon allzu verschiedene Haltung kontraproduktiv und langfristig auf eine andere Weise das Leben empfindlich einschränken würde. Handelt es sich aber um ein Fahrzeug einer experimentellen Bauart, durch die eine unversehrte Ankunft nicht mehr zu jenen 99,99997 %, sondern nur noch zu 98 % sicher ist, wäre trotz der in anderen Kontexten gering erscheinenden 2 % Risiko - insbesondere angesichts des freizeitlichen Zwecks - die unversehrte Ankunft vorab als Faktum anzusehen als Leichtsinn und somit illegitim zu beurteilen. Auch würde kein rationaler Mensch mit einem nur geringen Appetit auf eine Frucht, die nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 % nicht-tödlich ist, diese konsumieren. Anders wiederum sähe aus, wenn es sich bei dem unsicheren Gefährt um einen Krankenwagen und bei dem Fahrer um eine Rettungskraft handelt und es kein alternatives Fahrzeug und keine andere Möglichkeit gibt, mehrere am Zielort bedrohte Menschenleben - die eigenen Kinder der Person - zu retten. Hier wäre, wenn sonst die Überwindung zur Fahrt erheblich gefährdet wäre, die Ankunft vorab als Faktum anzusehen auch bei „nur“ 98 % eine Pflicht für sie. Diese Pflicht verkleinert sich, je unsicherer die Fahrt für die Rettungskraft ist, bis sie bei Unterschreitung eines gewissen Prozentwerts verschwindet und sich unterhalb eines noch niedrigeren Prozentwerts in eine Verwerflichkeit umkehren kann (zumindest wenn es nicht die eigenen Kinder o.ä. sind, sowie je nachdem, um wie viele Menschenleben es geht, und - im Verhältnis dazu - die Rettung wie vieler die Rettungskraft in ihrem Berufsleben erwartungsweise noch vor sich hat). - Bei einem Wahrscheinlichkeitsgrad von nur 20 % wiederum für das Gelingen einer absolut lebensnotwendigen Operation hat der Patient zur Unterdrückung des Fluchtimpulses das Gelingen zu faktualisieren. Gleichwohl muss er zuvor temporär das Gegenteil faktualisieren, um seine Pflicht hinsichtlich Testament und Versöhnung mit Verwandten etc. einwandfrei erfüllen zu können. (All dies natürlich nur soweit es die Psyche zulässt...)
Die sich hier abzeichnende Regel besteht aus zwei komplementären Sätzen: a) Je größer der durch eine Faktualisierung gewürdigte bzw. gewahrte ethische Wert v (solange sie zu diesem Zweck alternativlos ist), desto niedriger die Schwelle pt, und je kleiner desto höher. b) Je größer der durch Faktualisierung missachtete bzw. bedrohte ethische Wert, desto höher die Schwelle und je kleiner desto niedriger.
Unter der naheliegenden Annahme der Proportionalität bietet sich für (a) eine einfache Formel für die Induktionsschwelle an: pt = 100% - v. Geht es demnach beispielsweise um einen Wert, dessen Höhe 85 % der Skala der positiven Werte einnimmt, genügt für die feste Annahme, dass die vom Subjekt nicht beeinflussbaren (!) faktualen Bedingungen für die erfolgreiche praktische Wahrung des Wertes (bzw. seine angemessene Würdigung) erfüllt sind, eine Wahrscheinlichkeit von 15 %. Geht es um etwas Positives von relativ geringfügigem Wert, z.B. 3 %, sind 97 % erforderlich. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass hier jegliche Faktualisierung oberhalb der Schwelle eine ethische Pflicht ist, unterhalb ihrer aber strenggenommen eine Verwerflichkeit - dies aufgrund des ethischen Ranges der Wahrheit und somit der Erforderlichkeit, sie nicht mit etwas gleichzubehandeln, dass eine geringere Würdigkeit besitzt, als Faktum anerkannt zu werden. - Aus der Formel folgt im Übrigen, dass im Falle eines negativen ethischen Wertes die Induktionsschwelle oberhalb von 100% liegt, d.h. die Faktualisierung würde ausgeschlossen, und es ist gar als festes Faktum anzunehmen, dass die erwähnten Bedingungen nicht vollständig erfüllt sind.
Wie jeder andere Akt eines verantwortlichen Subjekts kommt auch eine Faktualisierung einem Wert va entgegen oder läuft einem Wert vb zuwider; bei den meisten Akten und Faktualisierungen ist beides der Fall, und mathematisch betrachtet bei jedem Akt und jeder Faktualisierung, denn in einer allgemeinen mathematische Formel, die sowohl (a) als auch (b) zugleich berücksichtigen soll, lässt sich der Fall, dass keinem Wert entgegengekommen oder keinem Wert zuwider gelaufen wird, damit gleichsetzen, dass einem Wert entgegengekommen bzw. ihm zuwidergelaufen wird, der 0 % der Skala einnimmt. Die Formel, welche die zwei komplementären Sätze in sich vereinigt, lautet daher:
Die auf dem aktionalen Charakter jeder bewussten Faktualisierung beruhende Ausnahmslosigkeit der Gültigkeit dieser Formel macht eine weitere Verfolgung des ersten Ansatzes zur Schwellendefinition überflüssig. Durch seine Zirkularität setzt er bereits etablierte Fakten voraus und eignet sich allenfalls als Ausweichmöglichkeit im Falle der Insuffizienz der Hauptdefinition. Wie jedoch zu sehen ist, lässt diese Formel kein potentielles Faktum übrig, das sie nicht selbst abdeckt. Damit dürfte sich auch jegliche Diskussion um eine „Willkürherrschaft“ der Ethik erst recht erübrigen.
3.2.5 Sonderfälle
Ohne die Berücksichtigung eines prekären Sonderfalls kann die Theorie allerdings nicht als vollständig betrachtet werden: Wenn va und vb gleich groß sind und sich gegenseitig aufheben, während zugleich die Fällung einer Entscheidung von höchster Dringlichkeit ist, z.B. weil sonst die ethisch wichtige Denk- und Handlungsfähigkeit bedroht ist (also der ethische Wert nicht dem Wie der Faktualisierung, sondern ihrem Dass zukommt). Eine solche Situation muss als eine Ausnahme betrachtet werden, denn die resultierende Schwelle von 100 % ist empirikbasiert nie erreichbar, was hier mit der eben erwähnten ethischen Anforderung kollidiert. Hier springt stattdessen eine provisorische 50%-Schwelle ein. Diese lässt sich als einzige ethisch rechtfertigen, da durch sie zwischen der Faktualisierung eines Sachverhalts und seiner Negation Vorrang schlicht dem eingeräumt wird, für das mehr spricht, und eine niedrige Schwelle Faktualisierungen zuließe, für die weniger spräche, sowie eine höhere Schwelle willkürlich und ohne hinreichende Rechtfertigung Faktualisierungen ausschlösse, für die im Verhältnis zu ihren Negationen mehr spricht. Hier ist die 50%-Schwelle schon deswegen die ethischste, weil sie unter allen Alternativen von Willkürlichkeit am weitesten entfernt ist.
Letztlich geht es bei der Bestimmung der induktiven Untergrenze generell um das Prinzip der Gerechtigkeit, bzw. dass diese gerecht platziert wird, d.h. dass sie in jedem Fall allein in regelhafter (!) Abhängigkeit von allen objektiv bereichsrelevanten ethischen Werten gesetzt wird, ohne dass Launen oder Begierden den geringsten Einfluss nehmen, und keine Faktualisierung gegenüber einer anderen bevorzugt wird, ohne dass sie es objektiv verdient.
Liegt die Induktionsschwelle denn dann in Zusammenhängen, in welchen kein ethischer Wert involviert ist, bei 100 %, so dass z.B. in reiner Naturwissenschaft keine echten Erkenntnisse möglich sind, sowie eine hinreichende Motivation unter der Prämisse, dass man als Forscher niemals zu festen Annahmen kommen dürfe, kaum denkbar ist? Tatsächlich muss zunächst eingesehen werden: Authentische und reine Naturwissenschaft lehrt keine naturwissenschaftlichen Fakten. Reine Naturwissenschaft ist eine Abstraktion von allen Fällen, in denen jemand aufgrund irgendeines praktischen Zwecks (persönlicher Ruhm, Geld, Freude an Forschen und Erkennen etc.) eine Faktualisierung in Bezug auf Sachverhalte des Kosmos vornehmen wollen könnte, und in einer solchen Abstraktion bleibt nur ein einziger Zweck von potentiell objektivem Wert übrig, welcher derjenige des wissenschaftlichen Fortschritts (der Wissen und Erkennen als solche einschließt) ist. Rechnung trägt diesem bereits das Experiment, das eine Wahrscheinlichkeit von z.B. 75 % für die Richtigkeit der zugrunde gelegten Hypothese anzeigt, zumindest wenn sie sich durch das Experiment als stärker als alle alternativen konkreten Hypothesen erweist. Eine darüber hinausgehende Erklärung der Hypothese zum Faktum trüge zum wissenschaftlichen Fortschritt normalerweise nicht das geringste bei und wäre aus naheliegenden Gründen hinsichtlich des Fortschritts als eher kontraproduktiv einzuschätzen. Reine Naturwissenschaft liefert daher das Material für Faktualisierungen, ohne aber diese Faktualisierungen selbst vorzunehmen; vielmehr nehmen diese (ob adäquat oder voreilig) Pharmazeuten, Mediziner, Ingenieure, Lehrer, Theologen, Philosophen, (Wissenschafts-)Journalisten und viele andere vor. Auch ein Naturwissenschaftler kann dies tun, ohne dass dies illegitim wäre, nur eben ist er in dem Moment kein reiner Naturwissenschaftler, sondern vielleicht ein Lehrbuchautor, ein Journalist, ein Richter oder einfach eine Privatperson (womit auch die Frage zur Motivation beantwortet sein dürfte). Durchaus gibt es naturwissenschaftliche Fakten; allein, reine Naturwissenschaft (welche keine reale Existenz besitzt) urteilt darüber im Allgemeinen nicht. Im Speziellen schließt dies allerdings nicht aus, dass ein Naturwissenschaftler auch als (allerdings individueller) Naturwissenschaftler innerlich eine bedingte Faktualisierung seiner Hypothese vornimmt, um sich zu einem kostspieligen Preisausschreiben mit dem Aufruf zur Widerlegung seiner Annahme zu befähigen, das wiederum den Zweck hat, den wissenschaftlichen Fortschritt voranzutreiben.
Ausblick
Was hinsichtlich der Fortsetzung des Artikels aussteht:
- Koordination, Bedingungen und Regeln bei der Anwendung der drei Komponenten
- Erörterung des epistemischen Wertes jeder Komponente
- Beispiele dafür, wie der Ehrwürdige Koran jede der drei Komponenten anspricht, sie voraussetzt, auf sie Bezug nimmt oder auf sie anspielt.
(natürlichen) Beschaffenheit, in der Gott die Menschen erschuf,in engem Zusammenhang stehen (Sure 30:30).
Erzählt den Menschen Dinge, die sie verstehen [können], oder wollt ihr etwa, dass Gott und Sein Gesandter der Lüge bezichtigt werden?) Bukhariy selbst versieht die Überlieferung mit einem Titel, mit dem er zu erkennen gibt, dass auch ihm diese Bedeutung des Verbes geläufig ist („باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا“). - Es scheint aber eine Folge der Abnahme der kulturellen Wertschätzung von Erkennen und Verstehen zu sein, dass das Verb in den heutigen Dialekten - abweichend von seiner Verwendung im Koran und in den Prophetenworten - praktisch nur noch „wissen“ bedeutet und hierin sogar das Verb 'alima („wissen“) verdrängt hat.
|Ärgernisse zu beseitigen ist obligat|, und der Untersatz dazu
|Nicht mehr schreibende Stifte sind ein Ärgernis|, und die Konklusion
|Nicht mehr schreibende Stifte zu beseitigen ist obligat|, die wiederum als Obersatz für einen weiteren Syllogismus dient, dessen Untersatz lautet:
|Dieser Stift schreibt nicht mehr|, so dass die Konklusion lautet:
|Diesen Stift zu beseitigen ist obligat|.
Anamnesis: Fundorte des Würdigkeitsbegriffs
Die Unverzichtbarkeit des Würdigkeitsbegriffs und die Unumgänglichkeit seiner Anerkennung)
|Obligates ist obligat|und
|Verwerfliches ist verwerflich|scheinen aus einander ableitbar zu sein. Dass Verwerfliches verwerflich ist, lässt sich nicht damit begründen, dass Obligates obligat ist, und umgekehrt. Zwar lässt sich, dass Verwerfliches zu tun verwerflich ist, damit begründen, dass Verwerfliches zu unterlassen obligat ist. Doch das führt erstens nicht direkt zu dem Satz
|Obligates ist obligat|, zumal hier zu ihm hin ein voreiliger Sprung zu bemerken wäre (oder ein Zirkelschluss), sondern zu der Begründung: „weil Verwerfliches verwerflich ist.“ Zweitens ist zwischen einer Handlung als reiner Idee und der Verursachung (Tun) ihrer realitären Entsprechung fein zu unterscheiden.
Zur Dynamik: Der Pool ethischer Sätze weist zwar ebenfalls ein Wachstum auf; dieses vollzieht sich jedoch hauptsächlich in der äußeren Schicht der Sphäre III und ist durch die Dynamik der Begegnung mit der empirischen Realität bedingt; der Kern und das hauptsächlich Maßgebliche der Ethik ist nicht veränderlich, teils von Beginn an (Nukleus, Sphäre I), teils früher oder später nicht mehr (Sphäre II), auch nicht mit zunehmender Erfahrung; unter dem Gesichtspunkt, dass vor allem der Ursatz unveränderlich ist und weder ersetzt noch jemals relativiert wird, sowie allein die eigentliche Ethik repräsentiert, ist dem Prüfstein der Ethik erst recht als statisch zu charakterisieren.
Zur Deduktivität der ethikdialektischen Methodik: In der Ethik kann sowohl die aus der Logik bekannte Deduktion zum Einsatz kommen (z.B. die Beurteilung der Entwendung einer fremden Geldbörse als unwürdig, weil diese zur Kategorie des Diebstahls gehört und diese Kategorie allgemein schon im Voraus als unwürdig feststand), als auch eine ethikspezifische Wertableitung auf Basis der Grundimplikationen; diese lässt sich im weitesten Sinne eine Deduktion nennen, insbesondere da sie der logischen Deduktion näher stehen dürfte als der Induktion.
Zum Fundamentalsatz der Empirik: Dieser ist im Sinne eines Keims und einer Voraussetzung für Empirik als Fundamentalsatz zu betrachten und wird im Laufe der zunehmender Erfahrung durch Verfeinerungen ersetzt.